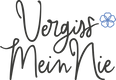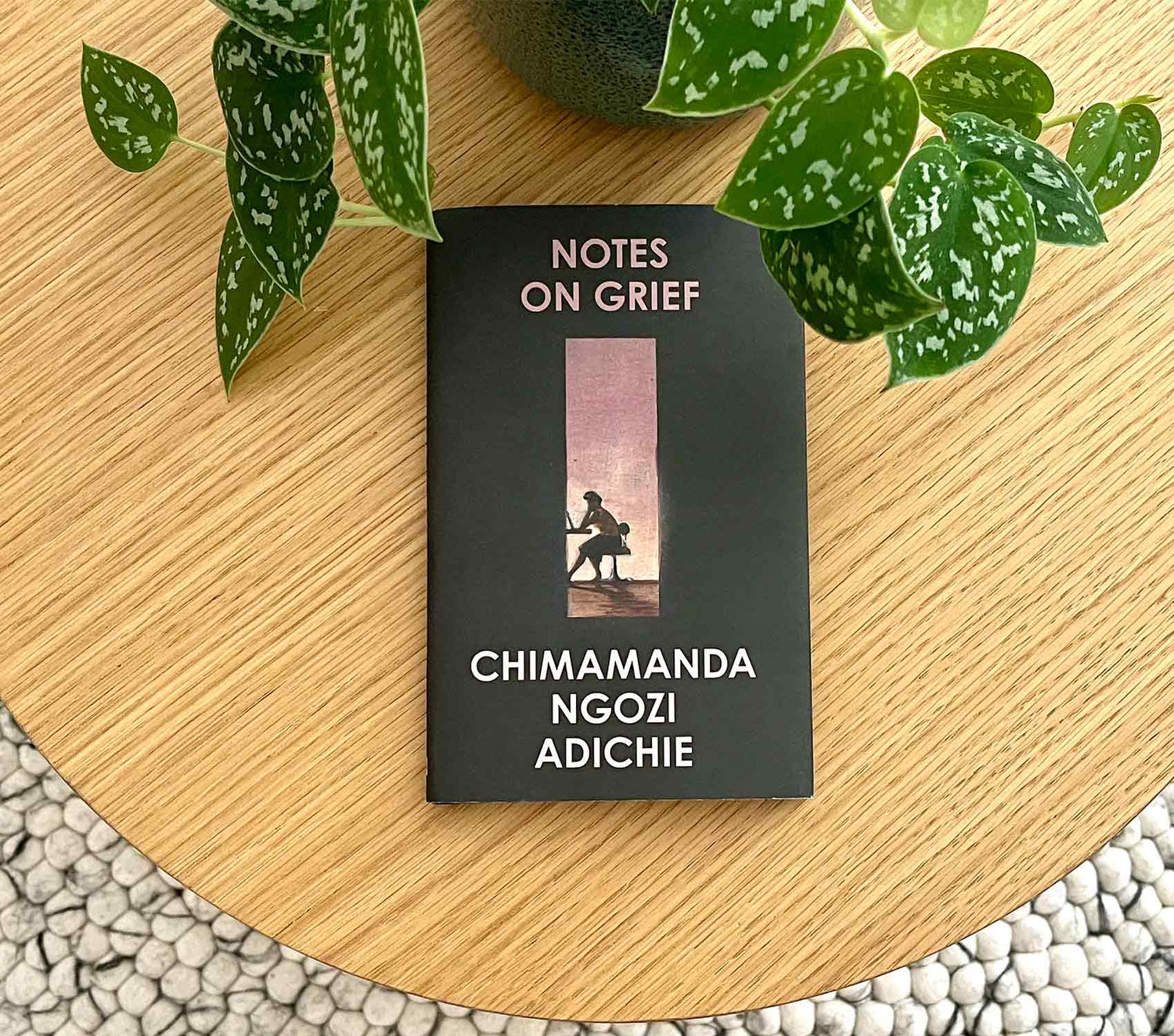Eine Trauerrede zu schreiben gehört zu den emotionalsten Aufgaben beim Abschiednehmen – und doch kann sie Trost spenden, Klarheit bringen und Verbundenheit schaffen. In diesem Beitrag geht es darum, wie persönliche Worte bei einer Beerdigung entstehen können – und warum es sich lohnt, sie selbst zu finden und aus zu sprechen.
Der Tod eines geliebten Menschen: eine ganz schöne Herausforderung
Das Leben hält ja bekanntlich so einige Herausforderungen bereit, das ist keine wirklich bahnbrechende Erkenntnis. Was uns besonders schwer- oder leichtfällt, variiert von Mensch zu Mensch. Wer sozial gut vernetzt ist, enge Freund*innen und/oder geliebte Angehörige hat, kann sich glücklich schätzen, muss aber auch mit Verlusten, Trauer und Abschied umgehen. Abschiede, seien sie durch Trennungen, Zerwürfnisse oder auch den Tod eines geliebten Menschen bedingt, gehören zum Wesen von Beziehung und Liebe dazu – unweigerlich. Dieser Beitrag dreht sich um die letztere und endgültigste dieser drei Abschiedsformen. Stirbt ein geliebter Mensch, ist die Trauerbewältigung wohl der unberechenbarste Part im Dschungel aller anstehenden „Aufgaben“ – denn ja, wer zum Beispiel schon mal einen Verwandten verloren hat, weiß, was es heißt, wenn der Tod sein bürokratisches Gesicht zeigt. Das Ende eines Lebens leitet für direkte Angehörige und testamentarisch eingesetzte Erb*innen eine Welle an organisatorischen Pflichten ein. Neben potenziellen juristischen Stolpersteinen, die wirklich wirklich zäh sein können, hat für die meisten aber ein liebevoller und würdevoller Abschied Priorität. Direkte Angehörige oder offizielle Erb*innen sind in Deutschland zudem bestattungspflichtig, sofern dies finanziell möglich ist.
Eine persönliche Trauerrede schreiben – zwischen Emotion, Erwartungen und der richtigen Wortwahl
Zu so einer Bestattung, Beisetzung oder Beerdigung – wie auch immer wir es nennen wollen - gehört dann für Viele neben individuellen Ritualen auch eine Trauerfeier mit einem oder mehreren mündlichen Beiträgen – persönlichen Trauerreden. Eine solche Rede zu schreiben und vorzutragen, fällt nicht allen leicht. Natürlich ist ein solcher Beitrag immer freiwillig und geschieht aus eigener Motivation. Trotzdem empfinden viele Angehörige beim Gedanken daran Erwartungsdruck – sei es durch die Familie, das Umfeld oder durch sich selbst. Auch Perfektionismus, Scham oder Angst vor dem eigenen Versagen können beim Schreiben ebenso lähmen wie beim Halten der Rede.
Obwohl vor allem die verstorbene Person in Würde und Liebe bedacht werden soll, rückt auch die Zuhörerschaft der Trauerfeier in den Fokus. Sonst könnte man sich das laute Vortragen, mit Verlaub, auch sparen.
Wie also findet man die richtigen Worte für den Abschied? Wie wird man dem verstorbenen Herzensmenschen gerecht, worüber hätte sie oder er sich gefreut? Und was denkt die Trauergemeinde? Was, wenn ich (zu sehr) weinen muss? Was, wenn ich meine Emotionalität im entscheidenden Moment gar nicht zeigen kann? Etwas vergesse? Zu viel oder zu wenig Bezug auf biografische Details nehme? An der ein oder anderen Stelle zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere? Oder sogar dort humorvoll bin, wo es eine andere Angehörige nicht verträgt? All diese Fragen sind verständlich – und zeigen, wie sensible diese Art des Sprechens ist.
Zwischenfazit: Trauerreden gehören zu den sensibelsten Reden überhaupt. Und trotzdem: dieser Text ist ein Plädoyer dafür, eigene Worte des Abschiedes zu finden und diese auch bei einem potenziellen offiziellen Anlass vorzulesen.
Eigene Erfahrungen mit dem Schreiben einer Trauerrede: Warum ich über den Trauerprozess sprechen möchte
Als Verfasserin dieses Beitrages sind mir all diese Fragen rund um das Schreiben und Halten einer Trauerrede vertraut. Vor nicht allzu langer Zeit ist ganz plötzlich ein enger Freund meiner Familie verstorben. Er hat uns nicht nur traurig und schockiert, sondern auch überfordert zurückgelassen. Auf einmal stand ich, neben der eigenen Trauerbewältigung, auch vor einem Berg Arbeit und hatte nicht nur eine Menge zu organisieren, sondern wollte mir auch größte Mühe für den Abschied geben. Aus dem Nichts, war ich für alles verantwortlich. Es war mir wichtig, mir etwas Schönes für den Abschied einfallen zu lassen und auch im Kreise seiner Lieben zu sprechen. Besonders weil der Tod so viel unpersönlichen Papierkram und wahnsinnig skurrile Termine mit sich bringt, wurde der Wunsch nach einem Raum für unsere Trauer groß. Ich schrieb also eine persönliche Trauerrede – oder plante zumindest, eine solche zu schreiben und bei der Trauerfeier vorzutragen. Wow. Traurig. Schwierig. Sensibel. Aufwändig.
Schreiben, freies Sprechen und Vortragen fiel mir eigentlich nie schwer. In der Schul- und Unizeiten hielt ich einige doch recht hochgelobte Referat. Allerdings über Goethe, Walther von der Vogelweide oder in der Grundschule über Hühner, Tapire und Koalabären. Später kamen berufliche Präsentationen und Vorträge hinzu – ähnlich routiniert und unemotional. Vor einem Jahr dann war ich zum ersten Mal Trauzeugin und beehrte meine frischvermählte beste Freundin mit einer ausschweifenden Rede rund um die Grandiosität ihrer Person – hier wurde es schon persönlicher und zwischendurch auch rührend. Aber eine Trauerrede – das ist was anderes. Besonders mitten im Schock des Verlustes, im Wust von bis dato unbekanntem Papierkram, ohne jegliche emotionale Distanz und mitten im tiefsten Trauerschmerz.
Natürlich muss niemand eine Trauerrede halten. In vielen Fällen fühlen sich Angehörige zum Zeitpunkt der Trauerfeier dazu gar nicht in der Lage oder möchten diese Form des Abschiedes schlichtweg nicht wählen. Mir persönlich hat das Schreiben der Rede und das Sprechen vor der Trauergemeinde im Verarbeitungsprozess der Trauer aber sehr geholfen. Dennoch kann ich verstehen, warum viele Angehörige diese Aufgabe gern abgeben. Es lohnt sich daher, einen Blick auf den kulturellen Kontext dieses Rituals zu werfen. Heute werden nämlich oft professionelle Trauerredner*innen engagiert. Früher waren Geistliche, Pastor*innen oder Priester*innen dafür zuständig.
Entwicklung und Bedeutung der Trauerrede in Europa
Die Trauerrede blickt auf eine lange Tradition zurück. Von religiösen Grabreden bis hin zu heutigen persönlichen Worten bei einer Beerdigung hat sich ihre Form stark gewandelt. Wer eine Trauerrede schreiben möchte, bewegt sich also in einem kulturell gewachsenen Ritual, das sich immer wieder an die Zeit angepasst hat.
Was die Forschung über Trauerreden verrät
Bei der wissenschaftlichen Recherche zur Geschichte und Entwicklung der Trauerrede fällt auf, dass es vornehmlich Theolog*innen sind, die zu diesem Thema forschen und publizieren. Zusätzlich findet man eine Fülle realer Grabreden auf bekannte Persönlichkeiten aus vergangenen Jahrhunderten – ausschließlich männlich dominierte Texte, meist von namhaften Herrschern für ebensolche. Eine einfache Internetrecherche führt dagegen schnell zu einer Vielzahl von Ratgeber-Artikeln zum Thema Trauerrede schreiben, oft ergänzt durch Beispiele für Trauerreden oder Strukturideen auf Bestatter-Websites mit Versprechen wie „damit Ihre Trauerrede möglichst persönlich wird". Das wirkt zunächst widersprüchlich: Mit einer standardisierten Vorlage zu arbeiten und gleichzeitig persönliche Worte zu finden. In der anfänglichen Orientierungslosigkeit kann das jedoch durchaus hilfreich sein. Darüber hinaus gibt es einige semin-wissenschaftliche Ratgeber von freischaffenden Trauerredner*innen für solche, die angehenden Kolleg*innen Hilfestellung bieten.
Von der Grabrede zur persönlichen Trauerrede bei einer Beerdigung
Die Trauerrede gilt als Teil sogenannter weltlicher Bestattungen und wird auch Grabrede, Leichenrede oder veraltet Parentation genannt. Das Wort leitet sich vom lateinischen parentatio ab, was „Totengedenken“ bedeutet. So steht es in der Theologischen Realenzyklopädie. Weniger gebräuchliche Begriffe sind „Begräbnishomilie“ oder „Begräbnispredigt“, die den Rahmen jedoch konfessionell einschränken.
Die Abgrenzung zwischen kirchlich gebundenen und überkonfessionellen Trauerreden ist ein wichtiger Aspekt innerhalb der Entwicklungsgeschichte dieser Tradition. So wurzelt, wie der Theologe Friedemann Merkel betont, die heutige Form der Trauerrede bei einer Beerdigung tief in der kirchlichen Tradition der Leichenrede, die in der Spätantike (ca. 3.–6. Jh. n. Chr.) ein Privileg der Mächtigen und ihrer Familien war. Ein entscheidender Vorläufer dieser Gattung war die Lobrede – ein feierliches Enkomion, das den Verstorbenen rhetorisch über die Zeit hinaus bewahrte. Erst mit der Reformation in der Frühen Neuzeit (16. Jhn.) wandelte sich die Leichenrede zur Leichenpredigt: Zunächst als feierliche Standrede gehalten, wurde sie später zur Grabrede – eine Form, die das Bürgertum ab dem 17. Jhd. dann begeistert übernahm und weiterentwickelte. Mit der Aufklärung und Säkularisierung um 1800 entstand schließlich eine weltliche Alternative zur kirchlichen Trauerrede. Der Fokus verschob sich von religiösen Lehren über das Jenseits hin zur Würdigung des individuellen Lebens der Verstorbenen. Das ist bis heute zentral, wenn Angehörige eine eigene Trauerrede verfassen, die mehr auf Erinnerungen und persönliche Geschichten setzt.
Mit der Entwicklung der Trauerrede in der Postmoderne (ab etwa 1950) aus kulturhistorischer Perspektive haben sich die Theologen Johann Pock und Prof. Dr. theol. Dipl. Psych. Ulrich Feeser-Lichtenfeld befasst. Sie arbeiten heraus, „dass die Kontexte der Trauerrede in der Postmoderne stark pluralisiert und die Erwartungshaltungen der Menschen sehr unterschiedlich sind.“ Institutionelle Rahmen für Trauerreden hätten sich gewandelt und seien heutzutage viel weniger an eine Konfession gebunden. Während eine Religionszugehörigkeit das Prozedere quasi immer noch vereinfachen würde, weil dann klar sei, dass Pastorinnen oder Pastoren entsprechende Reden halten würden, übernehmen nun zunehmen freie Trauerredner*innen diesen Part. In der Liturgie sei die Trauernde allerdings als nachrangig zu betrachten. Sie sind eher Teil des gesamten Ritus und stehen nicht unbedingt im Zentrum.
Konfessionsgebundene Trauerreden können als „Beziehungsreden“ zwischen Gott und Mensch gesehen werden, während freie Trauerreden die verstorbene Person allein in den Fokus stellen.
Bei freien Trauerreden liegt der Fokus daher stärker auf Biografie, Erinnerungen und der Würde beim Abschied nehmen.
Auffällig ist, dass die Forschung sich fast ausschließlich mit Trauerreden befasst, die aus der Familie ausgelagert, als Auftragsarbeiten oder Dienstleistungen, stattfinden. Institutionen – Bestatter*innen, Pator*innen und Professionelle – sollen diesen Part übernehmen, wobei die gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen das Vorgehen bestimmen. Freiheiten, die Pock und Feeser-Lichtenfeld nicht unkritisch kommentieren: „Die extrem individualisierten biografische Hintergründe und Erwartungshaltungen der Angehörigen zwingen dazu, Reden im Umfeld von Trauer und Tod biografisch zu verorten.“
Kirchennahe Vertreter*innen scheinen dem Konzept der klassisch konfessionellen Grabrede nachzutrauern. Die Theologen Thomas Klie und Jakob Kühn bestätigen, dass die traditionell kirchliche Trauerfeier mit Trauerrede heute in Deutschland in Konkurrenz zu nicht kirchlichen Angeboten steht. Der Anteil kirchlicher Bestattungen mit einer Rede durch konfessionelle Geistliche sei bei uns Stand 2016 auf unter 60% gesunden. Gleichzeitig steigt das Interesse daran, selbst eine Trauerrede zu schreiben oder sich von einem freien Trauerredner unterstützen zu lassen.
Professionelle Trauerredner*innen – zwischen Unterstützung und Distanz
Seit 1996 gibt übrigens die „Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerfeier“ (BATF e.V.), die klare Kompetenzanforderungen für ihre Mitglieder fordert und das Berufsbild für professionelle Trauerredner*innen klar absteckt. Auf der Website heißt es:
„Der Trauerredner erfasst das ganze Leben in seiner Daseinsgeschichte. Den von den Hinterbleibenden oft untergeordnet erzählten Erinnerungen und Anekdoten gibt er mit seinen eigenen Worten eine Form, die den verstorbenen Menschen noch einmal 'greifbar', 'sichtbar' und 'lebendig' werden lässt. (….) Der Trauerredner beachtet als 'Schwellenhüter' in der Zeit zwischen dem Eintritt des Todes und der Beisetzung in Zusammenarbeit mit dem Bestattungsinstitut und Friedhofspersonal sowohl die Bedürfnisse der unmittelbar Hinterbleibenden als auch die des Gestorbenen und der Trauergesellschaft. Um diese Aufgabe zu erfüllen, benötigen Trauerredner neben persönlichen auch umfangreiche Kompetenzen im fachspezifischen, sozialen und psychologischen Bereich.“
Hilfe, die sich nicht immer richtig anfühlt
Pock und Feeser-Lichtenfeld betonen, dass solche beauftragten Trauerreden „nur ein Moment im komplexen Geschehen von Trauerbegleitung und Trauerbewältigung“ darstellen. Inhaltlich drehten sie sich häufig um den chronologischen Lebenslauf der verstorbenen Person. Biblische Sätze und literarische Bezüge können hinzukommen. Ihr Aufbau sei auf ihre tröstende Wirkung und die Ehrung der toten Person ausgerichtet. Für Angehörige, die sich überfordert fühlen, kann es deshalb eine große Hilfe sein, eine professionelle Trauerrede schreiben zu lassen. Wenn du als Leser*in nun auch das Gefühl hast, dass das ziemlich unpersönlich klingt, dann empfindest du das ähnlich wie ich. Du möchtest ja auch niemanden mit dem Schreiben eines Liebesbriefes oder eines Tagebucheintrages beauftragen, auch wenn du diese in der Regel nicht coram publicuo vorliest. Eine Trauerrede kann ähnlich intensive Gefühle beinhalten. Gerade deshalb wünschen sich viele eine persönliche Trauerrede – mit eigenen Worten, echten Erinnerungen und einer Sprache, die die verstorbene Person wirklich widerspiegelt.
Eine professionelle Trauerrede kann ganz sicher entlastend sein, wenn man gerade im Trauerschmerz und Testamentsstress unterzugehen droht. Oder wenn es einem eben schlichtweg nicht im Blut liegt, Worte für so eine unbeschreibliche Situation aufzuschreiben oder vor Leuten zu sprechen. Auch Schüchternheit oder die Angst, bei der Trauerfeier zu weinen, führen oft dazu, dass Angehörige lieber einen Trauerredner*in beauftragen.
Doch Professionellen fehlt die persönliche Verbindung zur verstorbenen Person, was das Risiko erhöht, dass die Rede distanziert der inszeniert wirken könnte. Die Befürchtung, standardisierte Formulierungen und eine routinierte Vortragsweise könnten zu Lasten von Authentizität und emotionaler Tiefe gehen, scheint mir nachvollziehbar. Und das obwohl die meisten professionellen Trauerredner*innen sich meist vorab in intensiven Gesprächen mit den Trauernden auseinandersetzen, um die verstorbene Person bestmöglich kennenzulernen. Natürlich kann sich auch nicht jede*r den finanziellen Aufwand einer solchen Auftragsarbeit leisten. Die Kosten für eine professionelle Trauerrede variieren stark, je nach Region, Umfang und Dauer der Trauerfeier.
Ein ausschlaggebendes Argument gegen so ein Engagement und für das Selbermachen liegt in der aktiven Trauerverarbeitung durch Schreiben und Halten einer Trauerrede. Selten setzt man sich so intensiv und behutsam mit einem Menschen auseinander. Wer seine Trauerrede selbst schreibt, macht daraus nicht nur ein Geschenk für die Trauergemeinde, sondern auch einen wichtigen Schritt im eigenen Trauerprozess. Have in mind – dieser Text ist ein Plädoyer für deine eigene Trauerrede!
Warum wir bei Vergiss Mein Nie für das Selberschreiben einer Trauerrede sind
Eine Trauerrede ist keine gewöhnliche Rede. In meinem Empfinden ist sie eine, bei der man wirklich alles richtig machen möchte – besonders im Sinne der verstorbenen Person. Doch weil man sie vorträgt, schwingen auch gesellschaftliche Erwartungen mit. Und vielleicht Scham, Performancedruck, Trauer – eine wilde Mischung. Aber so geht es einem dann eben. Wir sind traurig, und wir sind Menschen. Sich durch all diese Emotionen hindurchzukämpfen – und am Ende doch vor den Hinterbliebenen zu stehen, um die Person, die für immer weg ist, zu ehren – das bleibt. Es ist ein sehr stärkendes und verbindendes Gefühl. Das Schreiben einer Trauerrede, das Reflektieren der eigenen Trauer und der Erinnerungen kann ein sehr heilsamer Teil des Trauerprozesses sein. Es ist ein Balanceakt zwischen Einfühlsamkeit und Selbstschutz, Angemessenheit und dem Überwinden der Angst vor starken Gefühlen. Wer eine Trauerrede selbst schreibt und sie bei der Beerdigung oder Trauerfeier vorträgt, erlebt oft, dass genau darin Kraft, Nähe und Verbindung liegen.
Trauerrede selbst schreiben – warum es sich lohnt
Eine selbst geschriebene und gehaltene Trauerrede kann ein entscheidender Schritt im Trauerprozess sein. Das Formulieren eigener Worte zwingt dazu, sich bewusst mit den Erinnerungen, der Beziehung zur verstorbenen Person und den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Dadurch wird die Trauer nicht nur durchlebt, sondern aktiv verarbeitet. Das Vortragen der Rede – auch wenn es schwerfällt – gibt dem Schmerz eine Stimme und macht die Verbindung spürbar. Im Gegensatz zu einer professionellen Rede, die oft distanzierter bleibt, schafft die eigene Trauerrede einen intimen Moment der Abschiednahme. Sie macht bewusst, dass die verstorbene Person nicht nur gegangen ist, sondern auch Spuren im eigenen Leben hinterlassen hat. In dieser letzten Würdigung liegt eine große Kraft: Sie hilft dabei, loszulassen, ohne zu vergessen, und macht aus der Trauer eine liebevolle Erinnerung. Für viele Angehörige ist das eine der wertvollsten Erfahrungen im gesamten Abschiedsprozess. Eine Trauerrede zu schreiben bedeutet nicht nur, über den Tod zu sprechen, sondern auch das Leben noch einmal zu würdigen.

|
Autorin: Chiara Lemburg-Augenreich
Chiara beschäftigt sich mit den großen und kleinen Fragen rund um Verlust, Trauer, Tod und Verarbeitung. Als Literaturwissenschaftlerin weiß sie, wo die fundiertesten und spannendsten Antworten zu finden sind und verbindet wissenschaftliche Recherchen mit ihrer ganz persönlichen Stimme. Ihre Texte für das Vergiss Mein Nie Magazin öffnen Denkräume und zeigen, dass das Ende des Lebens viele Geschichten erzählt. Und diese können manchmal nicht nur traurig, sondern auch unerwartet faszinierend sein.
|
Friedemann Merkel: Bestattung: Theologische Realenzyklopädie B. V, S. 747ff., Berlin u. a. 1980
Klie, Thomas; Kühn, Jakob (Hrsg.): Bestattung als Dienstleistung. Ökonomie des Abschieds, Stuttgart, 2019
Loke, Susanne: Einsames Sterben und unentdeckte Tode in der Stadt. Über ein verborgenes gesellschaftliches Problem, Bielefeld 2023
Pock, Johann ; Feeser-Lichterfeld, Ulrich(Hrsg.): Trauerrede in postmoderner Trauerkultur, Wien/Berlin 2011.
https://batf.de/