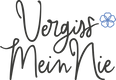Was passiert eigentlich mit digitalen Konten, wenn jemand gestorben ist?
Der digitale Fußabdruck eines Menschen bleibt über den realen, physischen Tod hinaus bestehen. Unsere digitalen Spuren verschwinden nicht einfach, Social-Media-Profile existieren vorerst einfach weiter, ebenso Online-Shopping-Konten, Spiele-Accounts oder andere Abos. Tatsächlich muss man sich oft noch zu Lebzeiten selbst um deren Verbleib kümmern oder jemanden mit der Pflege postmortem beauftragen. Besonders auf den prominentesten Meta-Diensten, aber auch bei X oder beispielsweise Tiktok bekommt das eine skurille Note.
Vor einem Jahr starb der Vater meines damaligen Partners. Einige Tage nach der Beisetzung kam es zu einer Situation, die wir nicht so richtig einordnen konnten. Es war komisch, ja ein bisschen unwirklich. Wir wollten den Sonntagabend mit einem Film auf einem der gängigen Streaminganbieter verbringen und meldeten uns über Christophs Account an. „Wir nutzen gerade offiziell das Profil eines Toten“, sagte mein Freund irgendwie sarkastisch. Stimmte ja aber. Das Konto war noch aktiv, wie viele andere von Christophs Profilen, Abos und Mitgliedschaften. Ausgehend von dieser Feststellung kamen wir auf die Frage: Was ist eigentlich mit seinem Facebook- und Instagramprofil? Tiktok hatte er nicht, aber bei X und natürlich Whatsapp war er auch.
Bei der näheren Beschäftigung mit diesen Fragen fiel uns auf, dass digitales Gedenken längst fester Bestandteil unserer Trauerkultur geworden ist. Aber wie läuft das ab? Und ersetzt es sogar andere Traditionen? Wie wirkt sich eine Fülle von anteilnehmenden Kommentaren auf Hinterbliebene? Diesen Fragen wollte ich auf den Grund gehen.
Digitales Erbe – Wer kümmert sich um Online-Konten?
Viele Länder handhaben den Verbleib von Online-Konten rechtlich als Bestandteil des Erbes, dessen Verteilung im Idealfall in einem etwaigen Testament festgelegt wird. Man spricht dann von einem digitalen Nachlass (das, was an Daten hinterlassen wird) und digitalen Erbe (das, was Erben auch tatsächlich antreten). Die Forschung diskutiert diese Themen außerordentlich kontrovers. Hier geht es schließlich um die Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Die Frage des Zugriffs ist zudem immer eng mit der Frage des Eigentums verknüpft. Der digitale Nachlass ist aber immateriell und in unkontrollierbare Himmelsrichtungen verstreut: „Zu Lebzeiten ist dies eine normale Begleiterscheinung der zunehmenden Digitalisierung und Virtualisierung des täglichen Lebens. Im Todesfall wirft diese Immaterialität jedoch Problematiken auf, die den Umgang mit dem digitalen Nachlass eines Verstorbenen für den Hinterbliebenen komplizieren“, wie Autor*innen der Monografie zum Sterben und Erben in der digitalen Welt wissen. Die Rechtslage ist kompliziert: Laut der Internetseite erbrechtsinfo.com fallen Daten als immaterielle Güter nach deutschem Recht (§ 90 BGB) je nach Art der digitalen Hinterlassenschaft unter das Erbrecht, das Urheberrecht (§ 31 UrhG) das Datenschutzrecht (DSGVO/BDSG für personenbezogene Daten), das Vertragsrecht (BGB für Online-Abos, Cloud-Dienste) sowie das postmortale Persönlichkeitsrecht. Expert*innen raten dringend dazu, digital vorzusorgen, per Testament oder Vollmacht, um Streitigkeiten oder auch unangemessene Situationen durch Fortbestehen von bspw. Instagramprofilen zu vermeiden: „Wenn Interntnutzende ihren digitalen Nachlass regeln, schaffen sie Transparenz und lösen die Zugriffsproblematik für die Angehörigen im Todesfall.“ Die Metaplattformen Instagram und Facebook bieten allerdings an, Profile von Verstorbenen in einen sogenannten Gedenkzustand zu versetzen. Diese bieten auch entfernten Bekannten oder sogar Fremden - auch in einem anonymen Modus - die Möglichkeit, ihre Anteilnahme auszudrücken, ganz schnell, zwanglos und von weit weg.
Der Tod auf Social Media – digitales Gedenken
Bei Social Media bekommt das Fortbestehen des digitalen Fußabdrucks eine neue Dimension. Hier scheint die Person lebendig zu sein, man sieht sie in allen möglichen Lebenssituationen auf Videos, Fotos, in Reels und Stories. Man hört ihre Stimme und kann ihre Worte lesen. Sie bewegt sich. Social-Media-Profile sind irgendwo sehr greifbare Zeugnisse eines Lebens, digitale Abbilder einer Person, mit der wir nie wieder wirklich sprechen können. Das kann Trauernde ganz schön mitnehmen und im Abschiedsprozess Wunden aufreißen. Der Mensch verschwindet nicht mehr so natürlich wie noch vor ein paar wenigen Jahrzehnten. Andere Trauernde freuen sich sicherlich auch über diese oft detaillierten Lebensausschnitte, wollen diese bewahren, aber auch er vor unangemessenem Zugriff schützen. Die kulturelle Praxis von Trauer, Tod und Sterben hat sich mit dem Internet im Allgemeinen seit langer Zeit maßgeblich verändert. Soziale Netzwerke spielen heute eine zunehmend bedeutende Rolle im Bereich der Anteilnahme in einem Trauerfall. Trauerforscher*innen mit soziologischem Fokus interessieren sich immer mehr für diese Thematik. Dabei drängen sich vor allem folgende Fragen auf: Was reizt so viele Menschen daran, digital zu kondolieren, auch wenn dies nur in Form von einem sehr kurzen Kommentar geschieht? Wie wirkt sich das auf die Trauernden aus, wird es begrüßt oder wird es vielleicht als Trivialisierung empfunden? Ersetzt das Entzünden einer virtuellen Kerze den Besuch auf dem Friedhof? Oder das R.I.P.-Kommentar die ausführlichere Kondolenzkarte oder mündliche Meldung? Und wer hat eigentlich Zugriff auf die Profile von Menschen, mit denen wir dort nie wieder real chatten können? Zur Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu wissen, wie die einzelnen, bei uns populärsten Social Media Plattformen eigentlich mit dem digitalen Tod umgehen.
Gedenkseiten bei Facebook und Instagram
Die beiden populärsten Meta-Plattformen ermöglichen es Angehörigen, Konten von verstorbenen Nutzer*innen zu melden. Bei der Recherche zu der Frage, was mit einem Instagramprofil im Regelfall nach dem Tod passiert, schreibt die Hilfeseite der Plattform: „Wenn du ein Konto auf Instagram siehst, das einer verstorbenen Person gehört, kannst du beantragen, dass es in den Gedenkzustand versetzt wird.“ Dieser Zustand gewährleistet, dass bestimmte Inhalte nicht mehr sichtbar sind und das Konto nicht mehr verändert werden kann. Zudem wird es durch die internen Algorithmen nicht mehr vorgeschlagen und man muss gezielt nach so einer Memorial Page suchen. Zusätzlich bietet Instagram die Erstellung privater und sogar weitestgehend geheimer Profile, sogenannter finsta an, auf denen nur explizit ausgewählte Follower*innen sich virtuell zusammenfinden. Als Familienmitglied oder berechtigte*r Erbe*in kannst du unter Vorlage der offiziellen Sterbeurkunde sogar die gänzliche Löschung des Kontos einer verstorbenen Person beantragen.
Facebook geht tatsächlich etwas weiter und spricht skurriler Weise die verstorbene Person zu Lebzeiten direkt an: „Du kannst entweder einen Nachlasskontakt bestimmen, der sich um dein Profil im Gedenkzustand kümmert, oder festlegen, dass dein Konto dauerhaft von Facebook gelöscht wird. Falls du keine Löschung deines Hauptprofils veranlasst hast, wird es in den Gedenkzustand versetzt, wenn wir über deinen Tod in Kenntnis gesetzt werden.“ Nutzer*innen haben also selbst zu Lebzeiten die Verantwortung, sich um den Verbleib ihres Profils postmortem zu kümmern. Ein Nachlasskontakt muss selbstständig ausgewählt werden und kümmert sich nach deinem Ableben um Freundschaftsanfragen, Profil- und Titelbild. Privatnachrichten können nicht gelesen und auch sonst nichts hinzugefügt oder gelöscht werden. Ganz schön viel Verantwortung, an die sicher nicht jede*r rechtzeitig denkt. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook erscheint vor dem Namen der verstorbenen Person ein In Erinnerung an.
Für unsere Fragen nach der sozialen Funktion solcher Gedenkseiten ist aber besonders interessant, dass Facebookkontakte unbegrenzt weiter auf den Seiten der verstorbenen Person kommentieren können. Bei Instagram bleibt diese Möglichkeit aus. Fest steht, dass täglich unglaublich viele Menschen und damit auch Social-Media-Nutzer*innen sterben. In einer Oxford-Studie fanden zwei Forscher heraus, dass Facebook bis zum Jahr 2100 mehr als 4,9 Milliarden verstorbene Mitglieder haben könnte, sofern die Plattform weiter wächst. Ohne Wachstum wären es sogar auch 1,4 Milliarden. Der Gedenkzustand und die Deaktivierung durch Angehörige wird von verhältnismäßig wenigen genutzt. So bleiben unzählige Facebook- und Instagramkonten einfach über den Tod hinaus aktiv.
Andere Plattformen wie X und TikTok: Keine Gedenkmodi
Andere Plattformen wie X und TikTok bieten keinen Gedenkzustand an. Konten bleiben also aktiv, bis sie durch Befugte gelöscht werden. Angehörige können eine Löschung beantragen, müssen aber eine Sterbeurkunde und einen rechtlichen Nachweis vorlegen. Das läuft über die Hilfeseite von X oder die Supportdienste von Tiktok. Auch hier existieren viele viele aktive Profile von Menschen, die nicht mehr am Leben sind und zu denen sich kein Zugriff verschafft wird oder verschafft werden kann. Viele Onlineshoppingseiten und Abos kündigen bei unterbrochener Zahlung übrigens einfach irgendwann die Mitgliedschaften auf.
Was bedeutet das für die digitale Trauerkultur?
Dass Social-Media-Profile nach dem Tod bestehen bleiben, hat Einfluss darauf, wie wir trauern. Während Friedhöfe physische Orte der Erinnerung sind, können digitale Profile ein virtueller Gedenkort werden. Manche finden es tröstlich, dort Erinnerungen zu teilen, andere empfinden es als belastend, wenn der Algorithmus sie plötzlich an Geburtstage oder vergangene Beiträge eines verstorbenen Menschen erinnert. Die Forschung beschäftigt sich zunehmend mit der Frage, wie die digitale Trauerkultur unser Verhältnis zum Tod verändert. Fest steht: Der Umgang mit der Datenflut auf Online-Profilen verstorbener Menschen bleibt eine Herausforderung – sowohl für Hinterbliebene als auch für die Plattformen selbst.
Was für die die Trauer auf Social Media spricht – Beileid anonym und ohne Druck
Soziale Netzwerke ermöglichen es gleichzeitig gemeinsam und allein für sich zu trauern. Man kann sich ganz zurückgezogen äußern, Timing und Worte selbst bestimmen, auch „weinen, ohne dass es gesehen wird“, schreibt die Sozialwissenschaftlerin Selina Fucker. Eine Person, kann „z.B. im privaten Rahmen die emotionale Fassung verlieren, wenn sie analog zuhause vor ihrem Gerät sitzt, gleichzeitig kann sie in der Öffentlichkeit ihre Fassung wahren.“ Gerade für junge Menschen und Jugendliche sei das hilfreich, wenn diese mit dem Offenbaren ihrer Emotionen im Kontext der Schule oder auch im Freund*innenkreis Probleme haben oder stark wirken wollen. Besonders finsta-Profile helfen trauernden Follower*innen, die eher zurückhaltend mit ihrer Trauer umgehen. Für schüchterne und ängstliche Menschen fällt so der Einstieg in einen hilfreichen Austausch oft viel leichter. Das betont auch der Theologe Bernd Tiggemann: . „In sozialen Netzwerken kann jeder so trauern, wie er will.“ Hemmungen und Ängste, nicht die richtigen Worte zu finden, lassen sich einfacher zerstreuen. Womit sich die ältere Generation schwer tut, kann auch eine „gewisse Leichtigkeit in die Trauer“ bringen. „Ein schnelles R.I.P. tut´s Zack, Fertig. Das würdest du den Angehörigen aber so niemals ins Gesicht sagen.“ „Digitales Erinnern kann als eine neue Form der Kranzniederlegung interpretiert werden, die, im Internet aufgezeichnet, langfristig gespeichert wird. Jeder:m ist mit einfachen Mitteln die Möglichkeit geboten, an einer Gedenkveranstaltung teilzunehmen, bzw. Teil einer Erinnerungsgemeinschaft zu werden.“ Voraussetzt man hat entsprechende Endgeräte und Internetzugang. Es ist heute legitim, im Netz zu trauern und damit natürlich auch Mitgefühl, bzw. Beileid auszusprechen. Menschen, die sich von dem Druck, persönlich angemessen zu kondolieren, überfordert fühlen, können sich hier bedeckter halten. Gerade junge Leute, die sich in den sozialen Medien besonders zuhause fühlen, könnten sich hinter anonymisierten Masken in „verstecken“, wenn ihnen persönlichere Varianten überfordernd vorkommen. Der Umstand, das Haus für eine sogenannte Gedenkgeste nicht mehr verlassen zu müssen, wird als von Vielen als Vorteil empfunden. „Die Hemmschwelle in sozialen Netzen ist einfach niedriger. Digitale Beileidsbekundungen sind einfacher und haben dann doch eine größere Reichweite“, so Tiggemann. Beiträge fallen einerseits teils knapper und weniger persönlich, allerdings auch oftmals kreativer aus. Außerdem sei „Gefühle schreiben (…) einfacher, als sie auszusprechen.“ Gedenkprofile geben Verstorbenen eine Rolle im Leben, Formen des kommunikativen Gedenkens werden über lange Zeit fortgeführt, Rituale und Erinnerungen geteilt. Und das hat auch eine globale Perspektive für historische Ereignisse, wie die Geschichtswissenschaftlerin Irmgard Zündorf weiß:
„Erinnern und Gedenken ist (…) nicht mehr ortsgebunden, sondern kann weltweite Partizipation erfahren. So wird „überregional und zum Teil transnational um Geschichte gerungen, werden Deutungsweisen diskutiert und dadurch Erinnerungskultur ausgehandelt. So entsteht das Potenzial globale Gedenkkulturen und Erinnerungsgemeinschaften zu erschaffen.“
Der Mehrwert für Trauernde auf Social Media
Trauernde selbst, so Selina Fucker fänden Trost, Halt und Empathie in der Gemeinschaft. Für trauernde Menschen, vor allem auch Jugendliche, die sonst vielleicht eher schüchtern sind, kann dieses Gemeinschaftsgefühl bei gleichzeitiger Anonymität darüber hinaus Hemmungen abbauen und es erleichtern, die Trauer zu teilen. So hilft die Anonymität im Fall von sozialem Druck beiden Seiten. Die Distanz macht das Öffnen leichter.
Positive Kommentare und Posts, aber auch Likes und Lesebestätigungen – sogar solche von Fremden – können in ihrer Quantität zudem als hohes Maß an Mitgefühl und als eine Mehr an Unterstützung empfunden werden. Die Fülle an Aufmerksamkeit erleben viele Trauernde trotz der Knappheit einzelner Kommentare als Wohltuend.
„Trauer digital zu äußern, hilft dabei, den Tod als Realität zu akzeptieren, denn digital geteilte Trauer wird sichtbar und als solche real“, so Fucker. Gerade durch Bilder und Worte erhält die Trauer Gestalt und Form, Schreiben kann Gefühle ordnen und bei der Emotionsreflexion helfen. Fucker verweist damit auf einen zeitgemäßen Baustein in der Trauerarbeit. Auch Tiggemann sieht in den sozialen Medien eine große Chance für die Trauerarbeit- und Bewältigung. Es sei Zeit, „die Menschen dort aufzusuchen, wo sie sind. Und das wird auch immer mehr im digitalen Raum sein.“
Wer sich übrigens von vielen Beleidsbekundungen überfordert und überrannt fühlt, spürt hier weniger den Druck, aus Höflichkeit schnell oder überhaupt konkret zu reagieren.
Was spricht gegen Trauerposts und Gedenkprofile?
Vieles spricht aber auch gegen das digitale Gedenken. Verschiedene sehr unangenehme Szenarien sind leider auch denkbar. So kann es die Schwere des Schocks über den Tod eines geliebten oder bekannten Menschen verstärken, wenn die Nachricht uns schneller digital als persönlich erreicht. Der Verlust wird zwischen allen möglichen profanen Alltagspost erfahren, dies möglicherweise durch eine Person, die wir nicht kennen und durch den flüchtigen Blick aufs Handy. Die Nachricht kann uns unvorbereitet treffen. Es gibt in diesem Moment kein Gegenüber, das uns einfühlsam begegnet und auffängt. Auch Tiggemann weiß: „Der Nachteil sozialer Netze ist aber, dass Todesnachrichten in Sekunden um die Welt gehen. Angehörige werden immer häufiger durch soziale Medien über den Tod informiert und nicht durch geschulte Seelsorger und die Polizei.“ Gafferfotos von Unfallstellen verletzen in undenkbarer Weise. Besonders für jugendliche Nutzer*innen kann das eine traumatisierende Erfahrung sein. Leider ist es auch vorstellbar, dass über Social Medie intime Details über die Todesumstände der verstorbenen Person ans Licht kommen und sich unkontrolliert verbreiten. Missinformationen sind dabei ebenso schwer zu vermeiden. Für die Privatsphäre von Verstorbenen und Trauernden ist das dann natürlich unglaublich verletzend. Noch schlimmer ist die Vorstellung davon, dass auch Hasskommentare und Cybermobbing vor Verstorbenen und Angehörigen nicht Halt machen – besonders seit den Lockerungen der Faktenchecker bei Meta seit den US-Wahlen 2024. Social Media macht den Tod also auch im negativen Sinne zu einer öffentlichen Angelegenheit. Geschieht dies rücksichtlos, unbedacht und vorschnell, erleben besonders Trauernde dies als entwürdigend und verletzend. Tiggemann findet: „Ich sehe hier schon Regulierungsbedarf durch den Gesetzgeber. Ich halte vieles aber technisch gar nicht für durchsetzbar.“
Nicht zuletzt geht die Kanppheit vieler Beiträge der Anteilnahme zu Lasten aufrichtiger zwischenmenschlicher Anteilnahme. Ein kurzer Post ersetzt keine mündliche Meldung, keine Karte, keinen Brief und schon gar keinen persönlichen Besuch.
Digitale Trauer – Fluch und Segen
Social Media hat die Art, wie wir trauern, grundlegend verändert. Anteilnahme ist unkomplizierter, globaler, schneller möglich, die Fülle an Trost ist tatsächlich oft tröstend. Ich persönlich sehe im Weiterleben von Toten als Datenmaße auch als pervertierte Form kultureller Trauerpraxis. Ganz zu schweigen von den Gefahren der Verletzung durch schockierende Posts, Fake News oder digitale Hetze. Am Ende bleibt die Frage: Wie viel Öffentlichkeit tut der Trauer gut – und wo braucht es mehr Schutz für den persönlichen Abschied?
Nach dem gemeinsamen Filmeabend mit meinem damaligen Freund scrolle ich durch meine Whatsapp-Kontakte. Christophs Profilbild ist verschwunden. Whatsapp hat sein Profil 120 Tage nach seinem Tod gelöscht. Der Chat ist noch da. Meine letzte Frage an ihn, ob er und seine Frau schöne Weihnachten verbracht haben, bleibt für immer unbeantwortet. Und irgendwie, denke ich, gehört das eben heutzutage eben auch dazu, dass letzte Worte nicht nur nachhallen, sondern vielleicht noch nachzulesen sind. Immer und immer wieder.
Mein Freund hat sich damals für die Inaktivierung von Christophs Social Media Accounts entschieden. Allerdings existiert auf dem Facebook-Profil von Christophs Frau ein wunderschönes Foto, unter dem die ganze Digitaltrauergemeinde kommentiert hat.
Meine Liebslings Auswahl:
Thank you for the music.
Fly safe
Und ein einfaches: <3

|
Autorin: Chiara Lemburg-Augenreich Chiara beschäftigt sich mit den großen und kleinen Fragen rund um Verlust, Trauer, Tod und Verarbeitung. Als Literaturwissenschaftlerin weiß sie, wo die fundiertesten und spannendsten Antworten zu finden sind und verbindet wissenschaftliche Recherchen mit ihrer ganz persönlichen Stimme. Ihre Texte für das Vergiss Mein Nie Magazin öffnen Denkräume und zeigen, dass das Ende des Lebens viele Geschichten erzählt. Und diese können manchmal nicht nur traurig, sondern auch unerwartet faszinierend sein. |
Quellen:
1 Brucker-Kley, Elke; Keller, Thomas; Pärli, Kurt: Sterben und Erben in der digitalen Welt. Von der Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Borders, Winterthur 2021, S. 14.
2 https://www.erbrechtsinfo.com/vererben/digitaler-nachlass/ (02.03.2025)
3 Brucker-Kley; Keller, Pärli, 2021, S. 29.
4 Fucker, Selina: S. 69.
5 https://help.instagram.com/264154560391256/ (02.03.2025)
6 https://www.facebook.com/help/103897939701143?cms_platform=iphone-app&helpref=platform_switcher&locale=de_DE (02.03.2025)
7 Öhman, Carl J; Watson, David:Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online, Oxford, S. 1. Siehe auch: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951719842540 (03.03.2025)
8 https://help.x.com/de/rules-and-policies/contact-x-about-a-deceased-family-members-account (02.03.2025)
10 Fucker, Selina: # RIP – Digitale Kommunikation über Trauer, in: Caspary, Christiane; Zahneisen, Daniela (Hrsg.): Wenn der Tod im Klassenzimmer ankommt. Tod und Trauer in der Schule – (religions-)pädagoische Perspektiven, S. 67 – 80, hier S. 69.
11 Tiggemann, Bernd, In: Schrödel, Tobias: Der digitale Tod. Warum ich das Handy eines toten Mädchens knackte, Wiesbaden 2018, S. 110 – 121, S. hier S. 112 ff.
12 Tiggemann, 2018, 112 ff.
13 Zu Eulenburg, Amélie; Zündorf, Irmgard (Hrsg.): Konkurrenz um öffentliches Gedenken: Erinnerungskulturen im Raum Potsdam und Brandenburg, Bielefeld 2023, S. 23.
14 Fucker, S. 68.
16 Vgl. Fucker, Selina: # RIP – Digitale Kommunikation über Trauer, in: Caspary, Christiane; Zahneisen, Daniela (Hrsg.): Wenn der Tod i Klassenzimmer ankommt. Tod und Trauer in der Schule – (religions-)pädagoische Perspektiven, S. 67 – 80, hier S. 69.
17 Tiggemann, 2018, S. 118.
18 Vgl. Fucker, S. 70.
19 Tiggemann, 2018, S. 121.