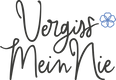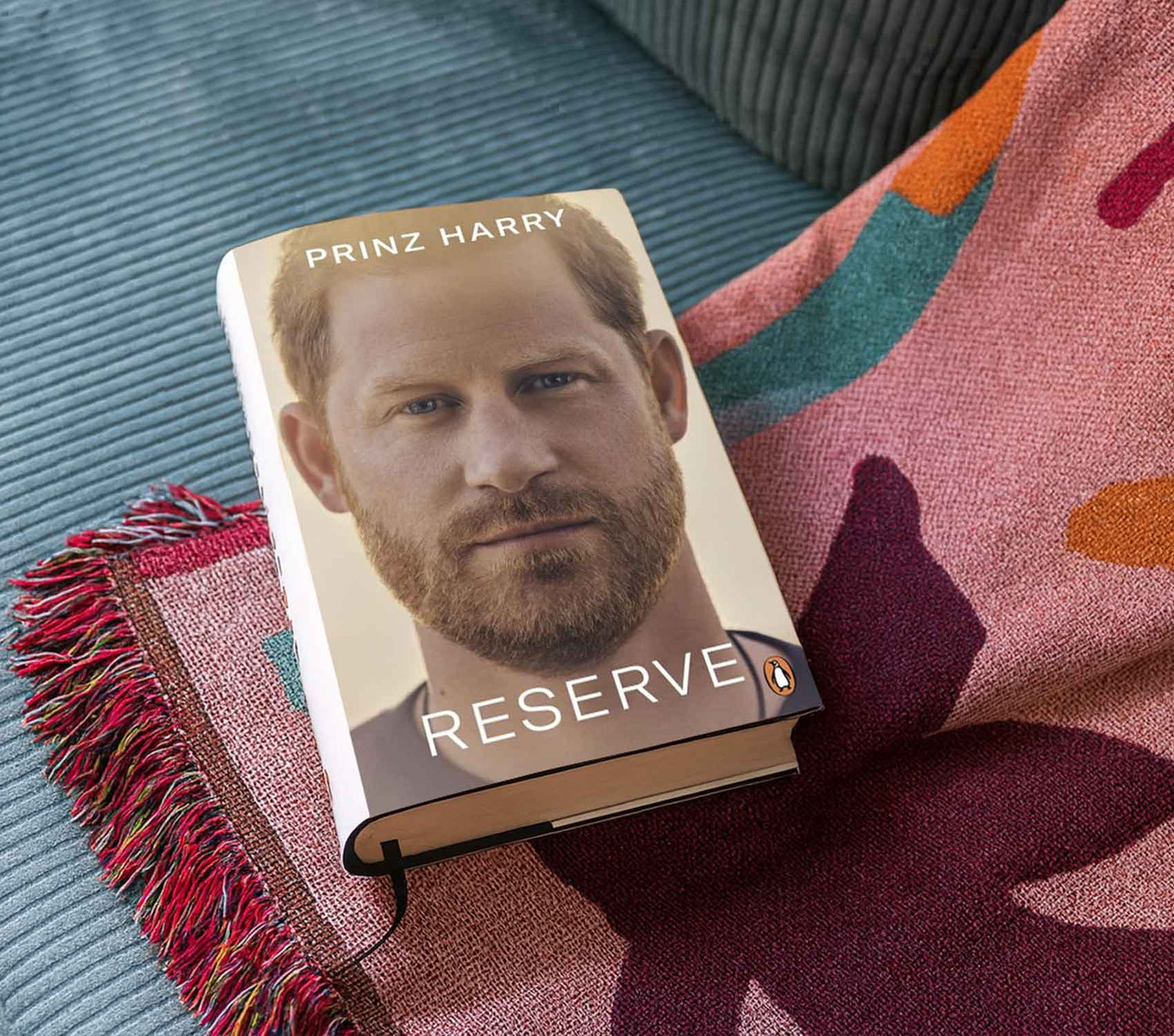Trauer begegnet uns nicht nur dann, wenn wir selbst jemanden verlieren. Auch im Umfeld, also bei Kolleginnen, Bekannten oder Nachbarinnen, stellt sich oft die Frage: Was sage ich zu Trauernden? Wie verhalte ich mich richtig?
Was sage ich zu Trauernden? Gedanken zur empathischen Kommunikation im Todesfall
Vergiss Mein Nie kümmert sich um Trauernde. Doch emotional wie auch inhaltlich ist Trauer ein weites Feld und betrifft nicht nur diejenigen, die selbst jemanden verloren haben. Je älter wir werden, umso häufiger machen wir Verlusterfahrungen - bei uns selbst und anderen. In einer außenstehenden Position betrifft uns der Schmerz dann mehr oder weniger sekundär, wir kommen in die Rolle des Beistehens, Anteilnehmens, Mitfühlens, Tröstens - geläufiger - des Kondolierens und Beileidbekundens. Das kann ganz intuitiv funktionieren oder total einschüchternd und überfordernd sein. Tod und Trauer sind nach wie vor Tabuthemen – auch im engsten Umfeld. Selbst unter Freund*innen oder in der Familie fällt es vielen schwer, offen über Verlust, Abschied und die eigene Trauer zu sprechen.
Im entfernteren Familien-, Bekannten- oder Kolleg*innenkreis ist es uns dann besonders wichtig, das Richtige zu sagen und/oder zu schreiben. Es sollte angemessen, diskret und dennoch emphatisch klingen - nicht zu viel und nicht zu wenig, nicht zu abgedroschen und nicht zu eindringlich, denn Beileidsbekundungen zwischen Floskel und Überforderung zu formulieren, fällt oft schwer. Was dabei auffällt, ist, dass die soziale Wirkung innerhalb der jeweiligen (gesellschaftlichen) Gruppe eine große Rolle spielt. Trauer und Beileid sind sozialen Normen unterworfen. Das kann Druck machen. Wenn eine Kollegin oder ein Kollege trauert, den wir nur aus dem beruflichen Kontext kennen, entsteht schnell Sprachlosigkeit. Womöglich fühlen wir uns hin- und hergerissen zwischen Fragen wie: Was darf ich sagen bei Trauer im Büro? Wie kann ich Anteil nehmen, ohne zu viel zu tun?
Do's & Don'ts bei Trauer – Ein Blick hinter die Tränen
Was sage ich bei Trauer, ohne Floskeln zu benutzen?
Beim Trösten von engen Freund*innen oder Familienmitgliedern fällt es oft leichter, Worte zu finden. Und trotzdem bringt auch diese Nähe Unsicherheit mit sich – denn Trauer kann selbst in vertrauten Beziehungen überfordern und uns zeitweise überwältigen und alles Gewohnte aus den Angeln heben. Die Erkenntnis, dem/der Anderen Schmerz nicht nehmen zu können, empfinden wir manchmal als Gefühl der Ohnmacht. Trösten kann also auch im engsten Kreis Druck auslösen.
Ich, die Autorin dieses Beitrages, habe es aktuell mit zwei ganz unterschiedlichen Trauerfällen zu tun. Ein Trauernder steht mir sehr nah, ein guter Freund. Eine andere Trauergemeinde trägt den gleichen Nachnamen wie ich, wir sind uns aber eher fremd. Natürlich möchte ich in beiden Fällen Anteil nehmen und mich richtig verhalten. Mir fällt auf einmal auf, dass ich an einer Stelle über meine soziale Wirkung und emphatische Kompetenz nachdenke, wo es eigentlich überhaupt nicht um mich geht. Irgendwie schade.
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Sprachlosigkeit und Überforderung, die Trauer und Anteilnahme oft auch innewohnen. Er soll Angehörigen, Freund*innen, Kolleg*innen und allen anderen motivierten Tröstenden Mut dafür machen, sich individuelle und aufrichtige Worte zu zutrauen.
Erste Hilfe in der Trauer: Was wirklich hilft – und was nicht
Kondolieren, Beileidsbekundungen, Anteilnahme: Was ist der Unterschied – und worauf kommt es an?
Was bedeutet kondolieren? Kondolieren, abgeleitet vom lateinischen condolere, das sich aus den Wortbestandteilen cum und dolere zusammensetzt, bedeutet im Wortsinn mit-Schmerz-empfinden, so sagt es der Duden. Man kann schriftlich - in Form eines Kondolenzschreibens oder einer Kondolenzkarte - und mündlich kondolieren. Beileid kann – je nach Beziehung zur trauernden Person – sehr formell oder ganz persönlich klingen. Gerade deshalb fragen sich viele: Was passt wann?
Zwischen den Begriffen des Kondolierens und des Beileidbekundens ist insoweit zu unterscheiden, als dass eine Beileidsbekundung allgemeiner gefasst sein kann und sich weniger auf die offizielle schriftliche Form bezieht, als das Kondolieren. So sagt der Linguist Christian Braun, dass „Kondolenzschreiben in sachlicher Hinsicht (bezüglich des Satzbaus und der Wortwahl) einen stark formelhaften Charakter aufweisen“. In seiner mündlichen Verwendungsspezifik meint Kondolieren, „dass ein Sprecher S einem Hörer H gegenüber zum Ausdruck bringt, dass er (Mit)Leid empfindet über den Zustand von H, der seinerseits Leid empfindet wegen des Todes einer Person, die ihm verwandtschaftlich, freundschaftlich oder beruflich/institutionell nahegestanden hat.“ „Formelhaft“ werden „mit Formulierungen wie `Mein herzliches Beileid´ Verbindlichkeiten oder Konventionen der Gesellschaft(sgruppe), der S angehört,“ zum Ausdruck gebracht. „Dies trifft in vielen Fällen von öffentlichen und offiziellen Kondolierensakten zu“, weiß auch das Handbuch deutscher Kommunikationsverben. Kondolieren und Beileidsbekundungen gelten also beide als Ausdruck der Anteilnahme.
Standardisierte Begrifflichkeit und Leitfäden können Sicherheit geben, gerade im professionellen Kontext. Dennoch, so weiß der Philosoph Hermann Braun, besteht die Gefahr, dass das Beileid in „routinierter Kommunikation bei Professionellen zu einer Grußformel werden“ kann, „ wie `Guten Tag´ oder `regnerisch heute´.“ Das Beileid als „Abkömmling des Mitleids“, wie er es etwas abschätzig betitelt, sei „originär nicht eine Bekundung der Trauer um Verstorbene, sondern eine Bekundung des Mitgefühls mit den Trauernden.“ Bei-zu-leiden betont eben die räumliche Präposition bei und drückt aus, dass man selbst nicht mit dem Leid identifiziert ist.
Ähnlich wie beim Mitleid, dem aber schnell eine überhebliche Komponente innewohnen kann, ist Beileid also als eine Art Beistand zu verstehen. Es ist ein Akt, nicht wie das Leid an sich ein Gefühl. Man selbst ist nicht direkt betroffen, hat aber trotzdem schwierige Emotionen zu dem Thema: Verunsicherung, Stress, Hilflosigkeit. Standardisierte Formeln können hier Orientierung bieten, damit wir der Befürchtung, Trauernden floskelhaft und damit seelenlos zu begegnen, etwas entgegenzusetzen haben. Das erklärt wohl die Fülle an Onlineratgebern, auf die ich bei meiner Recherche gestoßen bin.
Ob zur Beerdigung, zum Jahrestag, zum Geburtstag der verstorbenen Person – oder einfach zwischendurch: Eine liebevoll geschriebene Karte kann Trost spenden, Erinnerungen stärken und zeigen, dass jemand nicht vergessen ist.
Unsere Trauerkarten gestalten wir so, wie wir sie selbst gern erhalten würden: Schau sie dir hier an.
Der Forschungsstand - wenig Fachliteratur, viele Onlineratgeber
Tatsächlich existieren kaum valide Studien dazu, welche Formulierungen trauernde Menschen statistisch gesehen als besonders hilfreich empfinden oder was am Häufigsten gesagt wird. Stattdessen dominieren Onlineratgeber und Formulierungshilfen das Thema. Ob Kondolenzkarte, Gespräch oder Nachricht – viele Menschen suchen online nach Antworten auf die Frage: Was darf ich sagen bei einem Trauerfall? Was hilft, was verletzt? Die Unsicherheit ist groß – und verständlich. Man will auf keinen Fall etwas falsch machen, sich im Ton vergreifen, irgendwie invasiv oder zu distanziert auftreten. Zahlreiche Ratgebertexte helfen daher bei der Findung des richtigen Wordings beim mündlichen oder schriftlichen Kondolieren. Vor allem Websites von Bestattungsunternehmen bieten ausführliche Anleitungen, aber auch karrierebibel.de und andere kniggeähnliche Ratgeberseiten führen hilfreiche Tipps à la "Vermeide diese 13 Sätze bei einem Trauernden – Und was du stattdessen sagen solltest!". Auch in analoger Form gibt es eine Fülle an Ratgeberliteratur für das korrekte Verhalten bei der Konfrontation mit Trauernden – unter anderem den Tod, Trauer, Totenkult Knigge von Business-Coach Horst Hanisch.
Digitale Kondolenz: Wie Social Media Trauer verändert
Auch in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook zeigt sich, wie sich digitale Trauerkultur verändert. Es gibt unzählige Gedenkseiten – oft anonym, oft öffentlich. Hier legt die Forschung seit einigen Jahren einen neuen Schwerpunkt.
„Die Hemmschwelle in sozialen Netzen ist einfach niedriger. Digitale Beileidsbekundungen sind einfacher und haben dann doch eine größere Reichweite“, weiß der Theologe Bernd Tiggemann.
Schüchternen und unsicheren Nutzer*innen hilft die Anonymität. Der tatsächlich tröstende Effekt solcher vielfach eher unpersönlichen Beiträge ist auf die oft hohe Quantität zurückzuführen, einzelne Formulierungen sind nicht so wichtig. Und darum geht es ja am Ende bei jeder Anteilnahme: um Trost und vor allem um die Gefühle der Trauernden.
Mehr zum Thema "Kollektives Beileid auf Social Media" findest du hier in unserem Magazin.
Die Beileidsbekundung als „Trauernorm“
Manchmal ist Beileid kein Gefühl, sondern eine gesellschaftliche Erwartung. Ein Satz, der gesagt werden soll. Ein Moment, in dem ein Nicken reicht. Dieses Kapitel schaut auf genau solche Situationen – wenn Trauer nicht (nur) privat ist, sondern sozial eingebettet.
Wenn wir das Gefühl haben, funktionieren zu müssen. Oder etwas sagen zu müssen. Oder eben genau das nicht zu wissen. Zwischen innerer Unsicherheit und äußerer Form zeigt sich, wie sehr Trauer auch eine Frage von Rollen, Nähe und Kontext ist.
Wie Umarmungen in der Trauer helfen, kannst du hier nachlesen.
Was sage ich bei Trauer im entfernteren familiären Umfeld?
Kürzlich besuchte ich die Trauerfeier und Beerdigung meiner Großtante. Ich habe sie in meinem Leben vielleicht vier Mal gesehen und nie ein langes Gespräch mit ihr geführt. Sie ist mir als stilvolle und angenehme ältere Dame im Gedächtnis geblieben. Der Besuch der Abschiedszeremonie zu ihren Ehren war für mich selbstverständlich – vor allem auch, weil ich ein wenn auch entferntes, aber solides Verhältnis zu ihrem Sohn, dem Cousin meiner Mutter, habe. Ein Anlass, bei dem man gern Anteil nimmt und sich zu einem sozialen Verbund bekennt, auch wenn eigene Emotionen eine untergeordnete Rolle spielen.
Der Beisetzung ging eine Trauerfeier in einer kleinen, dem örtlichen Friedhof zugehörigen Kapelle voraus. Die Zeremonie folgte einem festen Programm, mit Musik, mündlichen Beiträgen und der Trauerrede einer Pastorin. Ich empfand es als recht traditionell-christlich, aber auch intim. Erst am Grab entstand schließlich erster Kontakt zu meinen entfernten Verwandten und damit die Herausforderung; was sage ich nun?
In einem Artikel dreier Soziologinnen zu historischen und gegenwärtigen Perspektiven bei Trauernormen in der Sozialwissenschaftliche Rundschau (SWS) heißt es:
„Trauer ist nicht nur ein individuelles, privates Gefühl, sondern wird sozial normiert und sanktioniert.“
Das bedeutet auch, dass sogenannte Beileidsbekundungen sozial normiert und an gewisse Erwartungen geknüpft sind. Meinen entfernten Verwandten gegenüber konnte ich beispielsweise keine authentischen Angebote hinsichtlich einer Unterstützung in der Trauerbewältigung im Alltag anbieten. Mein Zugang zu ihrem Trauerprozess blieb in gewisser Weise beschränkt und ein Eindringen durch allzu persönliche Worte und Nachfragen fühlte sich unangemessen an. In diesem Fall war es für mich sehr hilfreich, auf gewisse formelhafte Redewendungen zurückgreifen zu können. Mein Beileid wollte ich vermeiden, obwohl es von einigen anderen Trauergästen gar nicht so phrasenhaft klang.
Mit diesen weitverbreitete Formulierungen, die angemessen, schlicht und dennoch frei klingen, kann man aber nichts falsch machen:
-
„Ich fühle mit dir/euch und stehe dir/euch bei.“
- „Mein tiefstes Mitgefühl für dich/euch.“
-
„Alles Liebe und Gute für dich/euch.“
-
„Ich teile deine/eure Trauer.“
Spontan entschied ich mich für „Alles Liebe“ und „Die Zeremonie ist sehr schön und rührend.“ Selbstbeobachtungen und Korrektheitsansprüche mögen von Person zu Person variieren. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass viele Leser*innen so ein Denken schon mal bei sich festgestellt haben und daher dankbar für die genannten Orientierungsmöglichkeiten sind.
Unsere Trauerexpertin Anemone Zeim meint dazu:
"Alles ist besser, als nichts zu sagen. Die richtigen Worte gibt’s nicht – kein Satz der Welt macht den Verlust leichter. Wichtiger ist, der Trauernden Person ein Zeichen zu geben, dass der Schmerz gesehen wird. Und wenn es ein schlichtes: `Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da.´ ist."
Die Stichworte sind also Respekt, Aufmerksamkeit und Aufrichtigkeit. Ein paar unbeholfene Worte, auch phrasenhafte, geben mehr als Schweigen, auch wenn die Überforderung uns manchmal die Sprache verschlägt. Auch das dürfen wir zeigen, im Sinne von: "Hey, ich weiß einfach nicht, was ich dir sagen soll, weil ich befürchte, dass es deinem Schmerz vielleicht nicht gerecht wird.“
Kommunizieren wir unsere Unsicherheit, zeigen wir auch, dass wir uns Gedanken machen und dass uns die Situation des Gegenübers beschäftigt. Wir signalisieren außerdem, dass es uns um die trauernde Person und nicht um unsere eigene Korrektheit geht. Das kann zum Beispiel auch unter Kolleg*innen wichtig sein.
Nicht nur Worte und Karten, sondern auch Blumen können deine Botschaft und Anteilnahme übermitteln.
Trauer im Job: Wie Kolleg*innen trösten – ohne aufdringlich zu sein
Gerade zum Thema „Trauer am Arbeitsplatz“ gibt es erstaunlich viel Ratgeber- und Fachliteratur. Vielleicht auch, weil selbst Trauer in unserer Leistungsgesellschaft organisiert, eingeordnet – und manchmal still erwartet wird. Eine semiwissenschaftliche Arbeit von Trauerbegleiterin Franziska Offermann beschäftigt sich mit dem Umgang mit trauernden Kolleg*innen. Dabei unterteilt sie einen Bereich unter dem Titel "Zeiträume der Trauer" in:
- Die erste Zeit nach dem Tod,
- Vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz,
- Rückkehr an den Arbeitsplatz und
- Das Trauerjahr - BELEID bei der Rückkehr.
Die Expertin arbeitet heraus, wie dankbar Trauernde es aufnehmen, wenn ihnen „adäquat“, wertschätzend und interessiert begegnet wird: „(…) regelmäßiges ehrliches Fragen nach dem Befinden“, trotz Arbeitsstress mal Zeit nehmen, Hilfsangebote, einfach Zuhören, auch „offene und angstfreie Kommunikation über den Tod“ werden als tröstend empfunden. Viele Betroffene erleben es als hilfreich, wenn sie langsam wieder in den Alltag finden dürfen – mit Struktur, aber auch mit Rücksicht auf ihre veränderte Belastbarkeit.
Bei engen Bezugspersonen stellen wir uns seltener Fragen rund um Formulierungen und Diskretion. So kann ich zum Beispiel mit der Trauer eines engen Freundes natürlicher umgehen.
Trauer bei engen Bezugspersonen
Eine Auswertung von Statista zeigt auf die Frage Was konnte Sie im Zusammenhang mit dem letzten Todesfall trösten und in welchen Erlebnissen haben Sie Trost gefunden?, dass besonders das Zusammensein mit der Familie, Unterstützung und Zusammenhalt als hilfreich erlebt werden (26-33%). Das Gefühl von Gemeinschaft hat neben dem Hergang von Verlust und Abschied, den aller höchsten Stellenwert.
Trauer ist nicht planbar. Vielleicht gibt es Phasen, in denen Trauernde gern allein sind. Eine meiner Freundinnen berichtet, dass sie nach dem recht frühen Tod ihres Vaters Zeiträume brauchte, in denen sie einfach ungestört aus dem Fenster schauen konnte, ganz ohne Ablenkung oder Gesellschaft. Jede:r trauert anders. Und die Trauer funktioniert nicht linear – sie kann in Wellen kommen, uns als Grundrauschen begleiten, zwischendurch verschwinden und dann mit aller Heftigkeit zurückkehren. Wenn wir jemanden gut kennen und lieb haben, ist es unsere Aufgabe, diese Unberechenbarkeit auszuhalten und ein Stück weit mitzutragen.
Zusätzlich kann es helfen kleine Rituale für sich oder die Trauernden zu finden, beispielsweise einen Steinspaziergang oder das Entrümpeln des inneren Sperrmülls.
Was im Alltag hilft – zuhören, fragen, einfach da sein
Oft trösten wir nahestehende Menschen ganz intuitiv. Und doch überfordert uns der Tod – auch im engsten Kreis. Nähe schützt nicht vor Hilflosigkeit. Wir fühlen uns angesichts der Unkontrollierbarkeit des Geschehenen ohnmächtig, können unseren Freunden oder Verwandten diesen großen Schmerz nicht abnehmen. Wir leiden hier wahrscheinlich wirklich mit und sind trotz des hohen Grades an Vertrautheit vor dem Gefühl der Überforderung nicht gefeit. Wir kennen unsere trauenden Freund*innen, Partner*innen und Verwandten lange und gut und dennoch kann die Trauer sie verändern. Schwierige und verschlossene Phasen nicht persönlich zu nehmen, ist nicht immer leicht. Wir wollen helfen, vielleicht sogar gebraucht werden, haben aber keine Kontrolle über den Schmerz des Gegenübers.
Mein Freund, dessen Mutter gerade nach schwerer Krankheit gestorben ist, zeigt sich über ehrliche Nachfragen dankbar – was er heute oder genau jetzt braucht, Ruhe oder Gesellschaft. Worauf er Lust hat, ob er den Einkauf schafft. Ob er überhaupt weiß, was ihm jetzt gut tut? Ob er erzählen möchte. Ich versuche ihn in der Gegenwart immer da abzuholen, wo er gerade steht. Anstrengend. Aber auch nah und echt. Meistens gucken wir zusammen Filme und ich mache Salat.
Was hilft, wenn mir die Worte fehlen? – Tipps für den Umgang mit Trauernden
Es gibt keine perfekte Sprache für die Trauer. Und oft auch keine richtigen Sätze.
Aber es gibt Gesten, Fragen, kleine Angebote – die spüren lassen: Ich sehe dich. Ich bin da.
Gerade im Kontakt mit trauernden Menschen kann das schon reichen. Und manchmal eben auch nicht. Deshalb sammeln wir hier einige Gedanken, Formulierungen und Hilfestellungen, die in solchen Momenten tragen können. Nicht als Anleitung. Sondern als Ermutigung, überhaupt zu sprechen.
Was kann ich sagen, wenn ich die Person kaum kenne?
Manchmal stehen wir an der Seite von Menschen, die wir kaum kennen – und trotzdem fühlen wir, dass jetzt Worte gefragt sind. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nur echt. Aber was sagt man da?
-
Zeige, dass du den Verlust wahrgenommen hast: „Ich habe von deinem/Ihrem Verlust erfahren und möchte dir/Ihnen mein Mitgefühl ausdrücken.“
- Im beruflichen Kontext konkret entlasten: „Kann ich dir etwas abnehmen – vielleicht Kommunikation mit dem Team oder bestimmte Aufgaben?“
-
Zeige Anteilnahme durch kleine Gesten: eine Kondolenzkarte, Blumen, deine Anwesenheit bei der Trauerfeier – sie machen einen Unterschied, auch ohne viele Worte.
Wie begleite ich jemanden, der mir nahesteht?
Wenn uns ein lieber Mensch mit seiner Trauer begegnet, fühlen wir oft mit – und gleichzeitig eine Ohnmacht, weil wir nichts wegmachen können. Nähe hilft. Und doch fragt man sich: Was kann ich wirklich tun?
-
Fragen, ob die Person allein sein möchte oder ob du vorbeikommen sollst.
-
Um Ehrlichkeit bezüglich des Kontaktes bitten: sag mir, wenn dir etwas oder ich dir zu viel bin —> auch Anteilnahme kann zu viel werden.
-
In den Arm nehmen, wenn du weißt, dass die Person das mag.
-
Zusammen weinen ist okay.
-
Erreichbarkeit ausdrücken, auch wenn die Person weiß, dass du da bist: du kannst mich immer anrufen, ich bin da und schaffe Zeit für dich, so gut es geht.
-
Zwischendurch mal Alltagshilfe anbieten, wenn du die Kapazität hast: Kochen, Haushalt, Organisatorisches (vielleicht auch rund ums Abschiednehmen)
-
Wenn die Person Lust hat, eine schöne Ablenkung/Unternehmung planen.
-
Gemeinsame Ideen für den Abschied entwickeln (Kreatives, Erinnerungsorte, Gedenken)
-
Eine liebevolle Aufmerksamkeit vorbeibringen (Blumen, Gebäck, Gebasteltes, ein Buch)
-
Normalität und Alltag nicht ganz ausklammern: auch mal über was anderes reden, maßvoll von eigenen Themen berichten, gemeinsam Lachen.
Was immer hilft – unabhängig von Nähe oder Beziehung
Es gibt keine Formel für Trost. Aber es gibt Haltungen und kleine Gesten, die fast immer gut tun. Worte, die nicht perfekt sein müssen, sondern ehrlich. Und Angebote, die still zeigen: Ich bin da.
-
Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit in Worte verwandeln: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich bin für dich da und fühle mit dir/Ihnen.
-
Versuche den Schwerpunkt erstmal aufs Fragen zu legen: Gibt es etwas, das dir/ Ihnen jetzt gut tun würde? Kann ich dir/Ihnen dabei helfen? Kann ich dir etwas abnehmen? Möchtest du erzählen, drüber reden? Ich höre dir zu.
-
Gerade wenn der erste Schock vorbei ist, beginnt oft das eigentliche Alleinsein. Präsenz nach einigen Wochen kann besonders tröstlich sein.
Was du am Besten vermeiden solltest:
Manche Sätze tun weh – auch wenn sie trösten wollen. Gerade in der Unsicherheit greifen viele zu Floskeln. Dieser Abschnitt hilft dabei, solche Stolpersteine zu erkennen und ein bisschen sensibler hinzuschauen.
-
Trivialisierungen: Das Leben geht weiter. Kopf hoch. Sie/Er war doch schon so lange krank, es ist besser so. Du wusstest doch, dass das früher oder später passieren würde. Wenigstens hat sie/er nicht gelitten.
-
Überhebliches/Allwissendes: Jetzt ist sie/er im Himmel, da geht es ihr/ihm gut. Der Tod gehört zum Leben dazu. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Been there, done that. Jede:r hat ihre/seine Zeit, sei froh über die, die ihr gemeinsam hattet. Es ist Gottes Wille.
-
Das macht Druck: Bleib stark! Lass den Kopf nicht hängen! Sie/er würde nicht wollen, dass du jetzt so traurig bist und dich verkriechst. Bist du immer noch so traurig?
-
Das nervt, weil man es nicht immer beantworten kann oder will: wie geht es dir? Bist du noch traurig?
-
Vorsicht übrigens mit dem Angebot von ständiger Erreichbarkeit, wenn man dieser nicht verlässlich nachkommen kann (zum Beispiel bei großer Trauer morgens um 4 Uhr). Das geht im engsten Kreis auch meist nur in Akutphasen.

|
Autorin: Chiara Lemburg-Augenreich Chiara beschäftigt sich mit den großen und kleinen Fragen rund um Verlust, Trauer, Tod und Verarbeitung. Als Literaturwissenschaftlerin weiß sie, wo die fundiertesten und spannendsten Antworten zu finden sind und verbindet wissenschaftliche Recherchen mit ihrer ganz persönlichen Stimme. Ihre Texte für das Vergiss Mein Nie Magazin öffnen Denkräume und zeigen, dass das Ende des Lebens viele Geschichten erzählt. Und diese können manchmal nicht nur traurig, sondern auch unerwartet faszinierend sein. |
Quellen:
Deutsches Universalwörterbuch - Das große Bedeutungswörterbuch (10), Berlin 2023, S. 1052.
Braun, Christian (Hrsg.): Sprache des Sterbens - Sprache des Todes: Linguistische und interdisziplinäre Perspektivierungen eines zentralen Aspekts menschlichen Daseins, Berlin/Boston 2021, S. 48.
Erb, Sabine; Harras, Gisela; Proost, Kristel; Winkler, Edeltraud: Das Handbuch deutscher Kommunikationsverben, Berlin 2008, S. 335.
Braun, Hermann: Animal rationale - Ortsbestimmung einer anthropologisch fundierten Ethik, Bielefeld 2020, S. 135.
https://www.seelensport.at/vermeide-diese-13-saetze-bei-einem-trauernden/ (entnommen am 24.02.2025).
Hanisch, Horst: Tod, Trauer, Totenkult Knigge. Sterben, Trost, Takt, Bestatten, Tradition,
Vorsorge, Tabus, Vergänglichkeit und Sonderbares, Bonn 2019.
Schröder, Tobias: Der digitale Tod. Warum ich das Handy eines toten Mädchens knackte,
Wiesbaden 2018, S. 115.
Jakoby, Nina; Haslinger, Julia; Gross, Christina: Trauernormen: historische und gegenwärtige Perspektiven. SWS Rundschau, 53(3), Mannheim 2013, S. 253-274, S. 254.
https://chrispaul.de/wp-content/uploads/2024/01/Beileid-SZ-Interview-mit-ChrisPaul.pdf
(entnommen am 24.02.2025).
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1296159/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-trostspendenden-erlebnissen-nach-todesfall/ (entnommen am 24.02.2025).