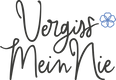Sexualität in der Trauer – darüber wird selten offen gesprochen. Nach einem Verlust denken wir an Schmerz, Leere und Halt; kaum an Lust, Intimität oder das Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Und doch berichten viele Trauernde genau davon – oder vom Gegenteil: von ausbleibender Libido. Dieser Beitrag schaut respektvoll auf beides und fragt, warum Sex in der Trauer kein Widerspruch ist. Wir beleuchten gesellschaftliche Erwartungen und Tabus, historische Wurzeln, aktuelle Forschung und die Biochemie von Trauer und Sexualität. Vor allem aber macht der Text Mut, Scham zu benennen, Sehnsucht zuzulassen und eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen – mit oder ohne neue Liebe. Kurz: Lust und Verlust dürfen zusammengedacht werden.
Doch bevor wir darüber sprechen, wie Lust und Verlust zusammenfinden können, lohnt sich ein ehrlicher Blick darauf, warum dieses Thema für viele so befremdlich ist.
Trauer im Herzen, Verlangen im Körper, Verwirrung im Kopf
Zugegeben: Sex ist wohl das Letzte, woran man im Zusammenhang mit Trauer denkt. Besonders, wenn jüngere Menschen – sagen wir vor oder um die Lebensmitte – ihre Partner*innen durch den Tod verlieren, wird allenfalls hinter vorgehaltener Hand gefragt: „Sie ist noch so jung… wird sie wohl noch einmal jemanden finden?“
An Sexualität oder Lust – losgelöst von Liebe – denken die wenigsten, wenn es um Trauer geht. Wenn ihr mutig seid, fragt mal im Freundinnenkreis: „Wie fühlt es sich für euch an, wenn jemand in Trauer um seinen Partner*in wieder sexuelle Nähe sucht oder Lust empfindet? Könnt ihr Trauer und Sexualität zusammendenken?“ In meiner Recherche für diesen Artikel habe ich genau solche Fragen gestellt – natürlich mit dem Hinweis, dass ich darüberschreiben werde. Das Ergebnis meiner kleinen „Feldstudie“ war eindeutig: Nur wenige sprechen offen über Sex in der Trauer, die meisten empfinden das Thema als unangemessen oder pietätlos. Es entstanden viele Schweigepausen. Auch auf mich selbst wirkte meine Fragerei irgendwie taktlos. Kein Wunder: Hier treffen gleich zwei große Tabus aufeinander – Tod und Sexualität.
Scham, Schuld und das Tabu der Sexualität in der Trauer
Natürlich möchte sich niemand vorstellen, den Tod der eigenen Partner*in zu erleben – allein der Gedanke daran ist kaum auszuhalten. Das wird meine kleine Fragestunde nachvollziehbarer Weise beeinflusst haben. Hauptgründe für das Schweigen vieler Trauernder sind Scham und Schuldgefühle – genährt durch gesellschaftliche Mythen und veraltete Vorstellungen von „richtiger“ Trauer. So etwas Lebensbejahendes wie Sex mit dem Lebensende in Verbindung zu bringen, das will man nicht laut aussprechen. Für viele Betroffene fühlt sich das schlicht falsch und beschämend an. Lange konzentrierte sich die Forschung zur Sexualität in der Trauer fast ausschließlich auf den Verlust der Libido. Auch dieser Verlust ist häufig – und sollte ebenso offen besprechbar sein. Denn Sorgen über fehlende Lust sind gesellschaftlich akzeptierter als Gespräche über aufkommende Lust. Fakt ist: Das Leben geht weiter – und wir bleiben sexuelle Wesen, auch in der Trauer. Sex in der Trauer is a thing! A Thing, das aus der Tabuecke raus sollte, weil es da nicht hingehört. Denn Sex ist - in jeder Lebensphase - ein Menschenrecht. Als solches definieren es übrigens auch die Leitlinien der WHO zur sexuellen Gesundheit und zu sexuellen Rechten. Jede*r hat das Recht, dieses starke, zutiefst menschliche Bedürfnis – auf ganz unterschiedliche Weise – zu leben, auch in Zeiten von Verlust. Die Arbeit mit Trauernden spiegelt die Relevanz dieses Themas und die Hemmungen, die damit verbunden sind. Begehren, Erregung, Lust und Sehnsucht nach Intimität und körperlicher Nähe treten in allen Phasen der Trauer auf und sind zu Unrecht so schambehaftet. Denn mit dem Tod der geliebten Person verschwindet auch diese besondere Nähe – und hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Dieser Artikel will Trauernde ermutigen, über Sehnsucht, Scham und Sorgen rund um Sex zu sprechen. Ihr seid richtig und normal. Und ihr seid damit nicht allein!
Das doppelte Tabu: Tod und Sexualität in der Trauer
Schauen wir uns die Gefühle und Emotionen rund ums Thema Sex in der Trauer einmal genauer an. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Wir sprechen hier über mehrere Tabus, Vorurteile – und subtile Formen von Diskriminierung. Erstens gilt für durch den Tod Getrennte oder Witwen und Witwer angeblich: Casual Sex oder körperliche Lust seien tabu, erlaubt sei nur eine neue große Liebe. Zweitens gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass die Sehnsucht nach Partnerschaft und/oder Sex nur in jüngeren Menschen aufkeimt und Alte damit nichts mehr am Hut haben. Beim Partner*innenverlust durch den Tod denken wir drittens oft wie automatisch an verwitwete Omis und Opis. Viertens ist Sex, der außerhalb einer romantischen Beziehung stattfindet, sowieso immer noch ein bisschen tabuisiert. Und zu guter Letzt klingt das fünfte Klischee im ersten und vierten schon an - Casual Sex und Trauer, das passt ja mal so gar nicht?! Weit gefehlt! Diese Mythen prägen unser Denken stärker, als wir glauben. Dabei zeigen Erfahrungen und Forschung längst ein differenzierteres Bild.
Sexualität und Lust in der Trauer: Zwischen Nähe, Scham und Verunsicherung
Zur allgemeinen Aufklärung: Viele Menschen sind bis ins hohe Alter sexuell aktiv oder haben mindestens sexuelle Sehnsüchte. Das gilt auch nach dem Verlust eines geliebten Menschen, sei es Lebens- oder Ehepartner*in. Wünsche nach Intimität, Lust und Erotik spielen bei Trauernden aller Altersgruppen eine große Rolle – entgegen der öffentlichen Wahrnehmung. Und das aus zwei Gründen: Entweder verschwindet die Lust zunächst völlig – oder sie taucht unerwartet und mitten in tiefer Trauer wieder auf. Beide Szenarien können verständlicherweise verunsichern. Die einen haben Angst, nie wieder ein sexuelles Leben führen zu können oder zu wollen, die anderen empfinden Scham und Schuld angesichts ihres vermeintlich deplatzierten Begehrens. Beide Reaktionen – und alles dazwischen – sind völlig normal und so individuell wie jede Trauer selbst. Unsere Libido wird nach dem Partnerverlust durch den Tod sowohl durch die Verarbeitung der Trauer als auch durch psychologische und biologische Mechanismen beeinflusst. Trauer und Sexualität können sehr nah beieinander, genauso gut aber auch meilenweit voneinander entfernt liegen.
Dieser Artikel möchte die Vielfalt menschlicher Reaktionen auf Verlust zeigen – und dich in deinen persönlichen Gefühlen sehen, verstehen und unterstützen. Ob du nun gar nicht an Sex denken kannst, ihn suchst, lebst oder haben willst, mit einer anderen Person oder mit dir selbst - bei Vergiss Mein Nie darfst du darüber reden.
Wissenschaft und Glaube: Warum Sexualität in der Trauer kaum erforscht ist
Der Theologe und Pfarrer Traugott Roser hat ein Buch mit dem Titel „Sexualität in Zeiten der Trauer – Wenn die Sehnsucht bleibt“ veröffentlicht. Er stellt fest, „dass das Thema Sexualität in der Trauer bislang auch in die vier Wände Betroffener eingesperrt gewesen ist.“ In seiner Recherche stieß Roser auf kaum wissenschaftliche Literatur: „In vielen Werken zur Trauerbegleitung finden sich nur am Rande Hinweise auf die Frage, was mit der Sexualität in Zeiten der Trauer geschieht. Als ob das kein Thema wäre! Es ist wie ein großes Schweigen, als ob es in der Trauer um Wichtigeres ginge.“ In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland beschreibt er außerdem, welche veralteten tradierten Vorstellungen mit dem „richtigen Trauern“ verbunden sind. Roser zufolge haben viele Menschen das Bild im Kopf, dass die Trauer um einen Menschen auch ein Ausdruck der Qualität der Liebe sei: „Dann ist die Dauer der – auch sexuellen – Treue ein Beleg für die Tiefe der Liebe.“ Das „Terrain“ der gemeinsamen Intimität gilt – auch symbolisch – als unantastbar. Als würde das die verstorbene Person auf einer tieferliegenden Ebene bedrohen oder ersetzen. Für manche wird der Tod des geliebten Menschen erst wirklich spürbar, wenn sich die eigene Lust langsam von der verstorbenen Person löst – und eine neue, unabhängige Sexualität entsteht. Und doch keimt Lust manchmal intensiv auf – paradoxerweise gerade dann, wenn der Mangel an körperlicher Nähe und die Endgültigkeit des Verlustes besonders schmerzen. Trauernde geraten dadurch oft in einen inneren Zwiespalt – und dürfen genau dafür Unterstützung suchen.
Im Umgang mit Zweifeln und Schuldgefühlen kann es hilfreich sein, den historischen Kontext zu betrachten, in dem der gesellschaftliche Druck auf Trauernde über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist. Es scheint, als erwarte die westliche Gesellschaft eine bestimmte Traueretikette von Hinterbliebenen, deren Nichteinhaltung oft mit sozialer Ächtung verbunden ist. Das hängt, wie Roser erläutert, auch mit dem hartnäckigen Glauben an das sogenannte Trauerjahr, in dem die Trauer das bestimmende Moment im Leben Hinterbliebener sein, danach aber auch wieder an Relevanz verlieren sollte. Ein Versuch, Gefühle zeitlich zu begrenzen – obwohl wir heute wissen, dass Trauer nicht linear verläuft. Dennoch hält sich dieser Anspruch an die Trauer zumindest unterschwellig. Wie lässt sich das historisch erklären?
Woher kommt das Tabu?
Der gesellschaftliche Anspruch, offensichtlich und für eine festgelegte Zeit zu trauern, beispielsweise durch Kleidung oder Verhalten, reicht bis in die Römische Republik zurück. Zwischen 500 und 100 v. Chr. galt in Rom das Konzept des tempus lugendi (lat. tempus = Zeit, lugere = traurig sein). Trauernde mussten rund zehn Monate lang auf Festlichkeiten verzichten und dunkle, schlichte Kleidung tragen. Die Dauer hing vom sozialen Status und vom Verwandtschaftsgrad zur verstorbenen Person ab: Entfernte Angehörige trauerten nur wenige Tage, engste Familienmitglieder deutlich länger. Selbst die offizielle Staatstrauer nach dem Tod eines Kaisers dauerte meist nur wenige Wochen. Trauer galt gemeinhin als Ausdruck von Pieta (Pflichtgefühl) gegenüber der Familie, aber auch den Göttern. Frauen waren dabei klar benachteiligt: Verwitwete Männer durften sofort wieder heiraten, Witwen mussten die vorgeschriebene Trauerzeit abwarten. Damit wollte man vermeiden, dass die Vaterschaft von Kindern, die nach dem Tod des Ehemanns geboren wurden, in Frage gestellt wurde und Erbschaftsstreitigkeiten drohten. Im 2. Jahrhundert n. Chr. wurden die bisherigen Fristen aufgrund der sich verändernden sozialen Ordnung auf ein volles Jahr erweitert und das altbekannte Trauerjahr, annus luctus (lat. Annus = Jahr, Lugere s.o.) entstand. Ziel blieb die Wahrung des guten Rufs – und die Abwehr von Schande. Jahrhunderte später griff Deutschland die Idee wieder auf: Mit § 1313 BGB (1900) führte das Bürgerliche Gesetzbuch eine zehnmonatige Wartefrist für Witwen ein, bevor sie erneut heiraten durften. Das Ehegesetz (EheG) von 1938 übernahm diese Vorgabe und sanktionierte Verstöße mit Strafen. Im Jahre 1946 griff das Kontrollratsgesetz Nr. 16 die Regelung auf, gewährte aber Ausnahmen und milderte die Konsequenzen, womit das ehemalige tempus lugendi quasi bedeutungslos wurde. Neun Jahre später wurde die Frist mit einem Beschluss der UdSSR-Führung in der DDR abgeschafft. 1997 hob das Kindschaftsrechtsreformgesetz (1997) das § 8 EheG auf und die staatlich geregelte Trauerzeit wurde rechtswirksam abgeschafft. Soweit so kompliziert. Und zum Kopfschütteln. Natürlich bezogen sich diese Gesetze und Vorschriften ausschließlich auf die offizielle Ehe. Denn Sex außerhalb dieser Institution berührte ja ein weiteres bedrohliches Tabu. Deutlich wird: Vor allem Frauen mussten über einen festgelegten Zeitraum signalisieren, dass sie „nicht zu haben“ und schon gar nicht zu schwängern seien. Andernfalls drohten Erbschaftsstreitigkeiten – und gesellschaftliche Schande. Jahrtausende von Sanktionen, Strafen und sozialer Ächtung haben einen Mantel aus Schweigen und Scham über das Thema Sexualität und Trauer gelegt. Kein Wunder also, dass sich viele Hinterbliebene bis heute schämen, über ihre sexuellen Sehnsüchte zu sprechen. Diese ganzen Zwänge sitzen wahnsinnig tief und verwandeln sich in Mythen, Schuldgefühle und Selbstzweifel. Wir von Vergiss Mein Nie wollen damit aufräumen – mit Wissen, Aufklärung und Wahrheit.
Die Forschung zeigt: Verlust und Lust schließen sich nicht aus
Die fachliterarische Landschaft zum Thema Sex in der Trauer baut primär auf neuro- und sexualwissenschaftlichen, psychologischen und aber auch theologischen Studien. Ergänzend finden sich in Interviews mit Trauerbegleiter*innen und Betroffenen sowie in persönlichen Erfahrungsberichten wertvolle, aufklärende Perspektiven. Der aktuelle Forschungsstand zeigt: Das Thema Sexualität in der Trauer wurde bislang erstaunlich wenig erforscht. Vielmehr war es die damit zusammenhängende Abwesenheit von Lust und Libido, die man zu erklären versuchte. Im Fokus stand dabei meist der biochemische Zusammenhang zwischen Trauer und dem Rückgang sexueller Lust – und das Bedauern über diesen hoffentlich nur vorübergehenden Zustand. Völlig fair und richtig! Neuere Studien nähern sich dem Thema einfühlsam und zeitgemäß – und untersuchen, wie Sexualität in akuten Trauerphasen integriert werden kann. Das fördert die Aufhebung von Tabus durch Aufklärung, Offenheit und Normalisierung. Weil das eben genauso wichtig und richtig ist! Es überrascht an dieser Stelle, dass explizit Arbeiten mit theologischem Hintergrund, wie die von Traugott Roser, Sichtbarkeit in die Debatte bringen wollen.
Wenn Verlust Nähe sucht: Warum Lust nach Trauer kein Widerspruch ist
„Oh ja, interessantes Thema“ – so lautet das Feedback zu meiner aktuellen Recherche in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Menschen, die offener reagieren. Aber die Scheu, sich Lust und Verlust gemeinsam zu denken begegnet mir überall. Dabei könnte man meinen, dass Einsamkeit und Verzweiflung nach dem Tod eines geliebten Menschen zumindest entfernt an das Gefühl nach einer Trennung erinnern – ganz entfernt natürlich. Aber da ist eine Leere, die manchmal sehr schwer zu ertragen ist.
Nach Trennungen entsteht dann in manchen Menschen der Drang nach Ablenkung, Bestätigung, Nähe, Verdrängen, Zuneigung oder körperlicher Aufmerksamkeit. Wieso sollte das so extrem anders sein, wenn die Beziehung durch den Tod getrennt wurde? Sind wir dann dazu verdammt, allen Sehnsüchten mit Enthaltsamkeit zu begegnen? Es erscheint mir unlogisch, dass das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Streicheleinheiten, Ablenkung und schönen Momenten nach einem Verlust einfach verschwinden soll. Viele stürzen sich nach Trennungen in sexuelle Begegnungen, suchen Ablenkung, Bestätigung, das intensive Spüren des eigenen Körpers – alles, nur nicht Traurigkeit. Ich wage die These, dass diese Bedürfnisse auch nach dem Tod eines geliebten Menschen auftauchen können – Betonung liegt auf können.
Körperliche Nähe in der Trauer: Wenn der Körper zum Erinnerungsort wird
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, stirbt auch ein Körper. Die Exfreundin eines verstorbenen Freundes stand vor einiger Zeit mit mir an seinem offenen Sarg. Eine ihrer Aussagen, ist mir eindrücklich im Gedächtnis geblieben: „Deine schönen großen Hände…“ Dabei strich sie liebevoll über seine gefalteten Hände. Die beiden hatten eine Körperlichkeit und Nähe geteilt, die ich mit ihm nicht kannte. Es wirkte auf mich zugleich befremdlich und schön – eine seltsame Mischung aus Intimität und Verlust. Der Trauerexperte und Psychologe Alan D. Wolfelt beschreibt in seinem Buch „Companioning the Bereaved“ (2013), wie tiefgreifend der Verlust körperlicher Nähe für Trauernde ist. Der Körper der geliebten Person sei zugleich Quelle von Trost, Sicherheit, Freude und Leidenschaft gewesen. Das physische Empfinden des Verlustes werde häufig vernachlässigt: „The death of a partner takes away not just the shared life but the shared physicality—the comfort of touch, the feel of another human being close at hand.“
Das plötzliche Fehlen dieser körperlichen Vertrautheit ist ein starker Auslöser für Sehnsucht nach Nähe – oft nach mehr als einer Umarmung von Freund*innen oder Familie. Ich gehe davon aus, dass ihr zu Lebzeiten der verstorbenen Person eine gemeinsame Sexualität erlebt habt – ob monogam oder nicht. Nicht nur die Person an sich fehlt dann überall, hinterlässt Leere und Einsamkeit, sondern auch ihre Berührungen, ihr Geruch, ihr Husten, Niesen, Schnarchen, Atmen, Lachen, Räuspern, ihre Stimme in allen Lebenslagen, der Fuß unter der Bettdecke, die Hände überall an deinem Körper und diese ganz bestimmte Zweisamkeit, die ihr auf eure ganz eigene Weise geteilt habt, fehlen. Der andere Körper fehlt. Mit all seinen Details, Macken und Eigenheiten, die du so gut kanntest. In deinem Bett, neben dir beim Zähneputzen, auf dem Beifahrersitz, auf dem Sofa vor der Glotze, in der Badewanne.
Wenn der Körper schweigt – und Nähe eine neue Form sucht
Die Kolumnistin Caroline Kraft zitiert in einem taz-Beitrag (2021) aus ihrem Tagebuch: „Ich war dir nah. Kannte deine Arme, deine Beine, deine Brust. Dein schöner Körper im Feuer.“ Sie erinnert daran, wie sehr der Körper selbst vom Tod betroffen ist und wie sichtbar der Verlust wird, wenn er still wird. Denn der Körper, neben dem du geschlafen hast, bewegt sich nicht mehr. Er wird kalt, steif, bleich. Wird verbrannt oder begraben und verwest. Diese besondere Form von Nähe mit diesem Körper, dieser Person, wird nie wieder möglich sein. Und genau hier kann es natürlicher Weise vorkommen, dass wir die Körperlichkeit unabhängig von der verstorbenen Person zu vermissen beginnen. Nach einem Verlust, dürfen wir unsere Sexualität neu entdecken, neu erfinden.
In diesem Zusammenhang greift der Artikel „Love and Loss: The Roots of Grief and Its Complicated Relationship with Sexuality“ (2016) von Jennifer M. S. das Thema Trauer und Sexualität auf und beleuchtet, wie tief verwoben diese beiden Bereiche sind. Die Autorin diskutiert, dass die physischen Bedürfnisse und sexuellen Sehnsüchte nach einem Verlust nicht nur als „unnatürlich“ oder „unangemessen“ abgetan werden sollten, sondern eine legitime Reaktion auf die Abwesenheit des geliebten Körpers darstellen: „Even in grief, the desire for physical intimacy does not necessarily cease, but instead may change shape, as people navigate the emotional and physical absence of their loved one.“ In dieser Formveränderung unserer Sexualität, spielen natürlich auch kleine machtvolle Botenstoffe eine Rolle - unsere Hormone.
Wenn Biochemie auf Emotion trifft: Warum Trauer auch körperlich wirkt
Lange galt in der Neurowissenschaft und Sexualforschung die Annahme, dass sexuelle Erregung und depressive Zustände sich gegenseitig ausschließen. Während der Forschungsschwerpunkt damit lange Zeit auf der Abwesenheit von Lust in der Trauer lag, verweisen neue Ergebnisse auch auf den genauen Umkehrschluss. Wenn wir sexuell stimuliert sind, egal ob durch Nähe oder Berührung, kann die Trauer für einen Moment in den Hintergrund treten.
Unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ, das auf verschiedenste Reize reagiert – manchmal auch in einem überraschenden Kontext. Trauer gilt als enorme Stresssituation oder Phase, die wiederkehrt und sich wandelt. Stirbt ein geliebter Mensch, übernehmen die Stresshormone Cortisol und Adrenalin vereinfacht gesagt das Steuer. Diese Botenstoffe sind anfangs hilfreich (sie versetzen uns in Alarmbereitschaft), machen uns aber auch anfälliger für Unruhe, Schlaflosigkeit, Wut, Grübeln und erschweren die emotionale Verarbeitung. Besonders dann, wenn sie die Ausschüttung von Oxytocin hemmen – dem sogenannten Kuschelhormon, das nach einem Partner*innenverlust ohnehin fehlt. Oxytocin wird vor allem bei körperlicher Nähe ausgeschüttet – besonders bei Menschen, die wir lieben – und in großer Menge bei einem Orgasmus. Diese intensiven Bindungserlebnisse fehlen nach einem Verlust oft von einem Tag auf den anderen. In der Folge all dieser Entwicklungen kann auch der Serotoninspiegel stark absinken, was uns wiederum depressiv und antriebslos macht und uns unsere Trauer spüren lässt. Ein weiterer entscheidender Player im Trauerhormonmix ist das Dopamin, das sogenannte Glückshormon, das bei Belohnung und Vergnügen ausgeschüttet wird. Es sorgt eigentlich für Motivation und Lebensfreude, ist aber in Zeiten der Trauer biochemisch bedingt gehemmt.
Und jetzt wird´s interessant! Entgegen der allgemeinen Annahme, dass Erregung und Trauer sich ausschließen, haben die Neurowissenschaftler*innnen Berridge und Kringelbach (2015) herausgefunden, dass das Belohnungssystem nicht nur in normalen, sondern auch in depressiven oder stressigen Zuständen aktiviert werden kann, wenn ein starker und relevanter Reiz wie Sex auftritt: „Even in states of low dopaminergic activity, the brain can generate transient bursts of dopamine in response to high-salience stimuli such as sexual activity, drug use, or unexpected rewards.“ Das Gehirn sucht in emotional belastenden Zeiten verstärkt nach schneller Belohnung. Bei Suchtverhalten kann das gefährlich werden – doch genau dieser Mechanismus erklärt auch das plötzliche Wiederaufkeimen von Lust nach dem Verlust einer geliebten Person. Wichtig ist: Sexuelles Verhalten darf in der Trauer niemals selbstschädigend werden. In einem stimmigen Maß, das auch Thema einer einfühlsamen Trauerbegleitung sein kann, hilft das durch Lust ausgeschüttete Dopamin, Lebensfreude zu bewahren.
Sexualität als Lebensfreude: Eine wahre Geschichte zum Schluss
Die für das späte 19. Jhd. außerordentlich progressiv lebende, denkende und schreibende Psychoanalytikerin und Dichterin Lou Andreas-Salomé (1861–1937) hat schon zu Lebzeiten ungewöhnlich offen und frei über Sexualität, insbesondere auch über die weibliche Sexualität gesprochen. So schrieb sie in ihrem Werk „Die Erotik“: „Sex und Erotik sind nicht nur ein Spiel der Sinne, sondern die lebendige Wurzel unseres Daseins.“ Im Gegensatz zu ihrem Kollegen Siegmund Freud, der die Libido als die alles durchdringende Triebfeder der Menschheit überall zu finden wusste, stellte Salomé Sex und Erotik als tief verwurzelte Lebenskraft, die mit Schöpfung, Identität und geistigem Wachstum verbunden ist, heraus. Ich mag diesen Gedanken von Sex als Lebenskraft und Lebensfreude, ganz entkoppelt vom biologischen Fortpflanzungstrieb. Wenn ältere Menschen ihre Partner*innen verlieren, spielt die Arterhaltung ohnehin keine Rolle mehr. Wie wir aus der Einleitung wissen, endet Sexualität weder mit der Rente noch mit dem Tod eines geliebten Menschen. Wir müssen unsere Lebensfreude nicht mitbegraben, unser Lachen und Genießen nicht der Dunkelheit überlassen. Wir leben.
Ein Beispiel dafür liefert die wahre Geschichte über eine 80-jährige Witwe aus meinem Verwandtenkreis, die direkt nach dem Tod ihres Ehemannes einen deutlich jüngeren Liebhaber aus dem Hut gezaubert hat. Sie kannte ihn noch aus der Berufsschule in den 60er-Jahren. Der Kontakt hatte wohl jahrzehntelang locker bestanden. Der Herr trat bereits wenige Wochen nach der Beerdigung auf den Plan. Man sichtete die beiden bei gemeinsamen alltäglichen Erledigungen, auch erspähte man bis dato unbekanntes Männerschuhwerk im Treppenhaus vor ihrer Tür. Hatte sie ihren Ehemann einfach ersetzt? In diesem Alter? Aus sicherer Quelle weiß ich aber auch: Noch heute, zehn Jahre nach seinem Tod, weint sie fast täglich vor dem großen Porträt ihres Mannes im Wohnzimmer. Niemand, der sie beobachtet, würde je infrage stellen, dass sie ihren Mann zutiefst geliebt hat.
Natürlich ist diese Geschichte über eine so betagte Frau vielleicht lückenhaft – aber sie räumt auf positive Weise mit dem Vorurteil auf, dass ältere Menschen kein sexuelles Begehren mehr hätten. Für viele wirkt sie wohl wie ein niedliches und zugleich hoffnungsvolles Beispiel. Fragt sich aber, wie Altersgenoss*innen und Nachbarschaft reagieren würden, würde sie ihre Liebschaft offen besprechen. Ich weiß nicht, wie offen sie über das Thema spricht – aber ich vermute, die Generation Silence geht mit solchen Details eher sparsam um.
Mir sind allerdings ein paar Interna bekannt: Erstens, dass diese ältere Dame Trost bei ihrer eher lockeren neuen Geschichte findet. Zweitens, dass diese vordergründig auf einer körperlichen Ebene fußt. Drittens und essentiell: im ersten schlimmen Schmerz nach dem Verlust ihres Lebenspartners und Vaters ihrer Kinder, hat ihr die Zuwendung, Aufmerksamkeit, Gesellschaft und körperliche Nähe enorm geholfen. Das Verhältnis besteht bis heute locker weiter. Meine These: Diese gelebte Lebensfreude schenkt ihr bis heute Vitalität und Leichtigkeit – selbst im hohen Alter.
Diese Geschichte mag wie eine Ausnahme wirken. Doch ich hoffe, dass viele – junge wie alte – Hinterbliebene sich diesen neuen Lebensentwurf erlauben. Dann, wenn sie spüren, dass er ihnen Kraft gibt. Mit oder ohne Liebe. Sex als frisch verwitwete Achtzigjährige. Warum bitte nicht?
Fazit: Sexualität in der Trauer ist Menschlichkeit. Sexualität in der Trauer ist kein Tabu, sondern Ausdruck von Nähe, Mut und Lebenskraft. Sie zeigt, dass wir leben, lieben und fühlen – auch nach dem Verlust.

|
Autorin: Chiara Lemburg-Augenreich Chiara beschäftigt sich mit den großen und kleinen Fragen rund um Verlust, Trauer, Tod und Verarbeitung. Als Literaturwissenschaftlerin weiß sie, wo die fundiertesten und spannendsten Antworten zu finden sind und verbindet wissenschaftliche Recherchen mit ihrer ganz persönlichen Stimme. Ihre Texte für das Vergiss Mein Nie Magazin öffnen Denkräume und zeigen, dass das Ende des Lebens viele Geschichten erzählt. Und diese können manchmal nicht nur traurig, sondern auch unerwartet faszinierend sein. |